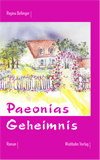Leseproben
Zur Leseprobe „Kaloum“
Zur Leseprobe „Die Männerflüsterin“
Zur Leseprobe „Paeonias Geheimnis“
Zur Leseprobe „Eine intergalaktische Freundschaft“
Zur Leseprobe „Der erfüllte Wunsch“
Zur Leseprobe „Erleuchtung im Alltag“

Kurzbeschreibung zu „Kaloum“:
Viele Menschen sprechen mit ihren Zimmer- und Gartenpflanzen, in der Hoffnung, dass sie so besser gedeihen. Auch für Jan ist das eine langjährige Gewohnheit. Aber eines Tages antworten sie ihm!
Für ihn beginnt damit eine besondere Ausbildung. Er lernt, wie diese Welt und das Leben eigentlich gemeint sind und findet seinen Weg zu Erfüllung und Glück. Doch dann wird er vor eine Entscheidung gestellt ...
In unserer Zeit sehnen sich die Menschen nach Sinn und persönlicher Spiritualität.
„Kaloum - Die Botschaft der Bäume“ erzählt von neuen Dimensionen und Möglichkeiten, sich zu entscheiden und zu entwickeln
Leseprobe I:
Am nächsten Morgen ging er wieder durch den Park. Die aufkommende Helligkeit des neuen Tages gab ihm Mut genug, das alte Spiel weiter zu spielen.
„’Morgen, Jungs!“
„Guten Morgen, Mensch!“
Er bekam
weiche Knie, sah sich um. Kein Mensch weit und breit. Nicht mal ein Exhibitionist in den Büschen, was ihn jetzt sogar beruhigt hätte. Seltsam, daß es Situationen geben kann, in denen ein Exhibitionist einen davor bewahren könnte,
sich für verrückt zu halten.
„Setz Dich zu uns und höre.“ Er fuhr herum. Es war wirklich niemand da. Er war allein in diesem Park und er hörte Stimmen. „Entweder nimmt mich jemand auf den Arm oder werde ich gerade verrückt,“ dachte er, „mikroskopisch kleine Außerirdische mit einem vergleichsweise grandiosen Stimmvolumen kommen auch noch in Frage.“ Er spürte, wie sich das Adrenalin in seinem Körper ausbreitete und atmete langsam und bewußt aus. „Wer ist da?“ fragte er halblaut.
„Um mit Deinen Worten zu sprechen: die Jungs!“
„Welche Jungs?“
„Erinnere Dich, daß Du uns vor wenigen Augenblicken gegrüßt hast.“
„Die Bäume?“
„Die Bäume – wie ihr uns nennt.“
„Okay, okay! Seid so gut und sagt mir zuerst, daß ich nicht träume und nicht verrückt werde....“
„Wir
sind uns bewußt, was dieser Eingriff in Deine Vorstellung von Wirklichkeit bedeutet. Aber wir haben beschlossen, wieder einmal Kontakt aufzunehmen, weil wir uns einen Mittler wünschen. Setz dich auf die Bank und laß uns reden.“
Er war froh, nicht länger auf seinen zittrigen Beinen stehen zu müssen und ließ sich auf der feuchtkalten Parkbank nieder.
„Ich muß ein paar Fragen stellen....“
„Frag ruhig. Wir wollen, dass du Vertrauen
faßt. Wir wissen, daß der Erstkontakt verwirrend ist.“
„Warum kann ich Euch hören? Wie funktioniert das, daß Bäume sprechen?“
„Es ist die Kraft unserer Gedanken, die für dich unsere Stimmen hörbar macht. Miteinander kommunizieren wir auf andere Weise. Ihr Menschen würdet es wohl am ehesten als Telepathie bezeichnen, eine Fähigkeit, die
ihr zwar besitzt, aber habt verkümmern lassen.“
„Warum redet ihr mit mir? Ich bin niemand Wichtiges. Warum nicht mit dem Parteivorstand der Grünen oder dem Präsidenten von Greenpeace? Und warum habt ihr euch nicht
allen Menschen verständlich gemacht? Warum jetzt?“
„Es gab durchaus Zeiten, in denen wir mit allen Menschen sprachen. Leider verfolgten die Menschen zu allen Zeiten ihre eigenen Ziele. Ein Mensch, der gewählt hat, Schlechtes
zu tun, käme in einer Welt voll Rücksichtnahme, Freundlichkeit und Gleichberechtigung auf keinen grünen Zweig. Er kann nur Macht erlangen, wenn er die anderen vergessen läßt, wie die Welt gemeint ist. Alles geriet in
Vergessenheit. Unsere Welt und eure Welt entfernen sich immer mehr voneinander. Wir suchen jemanden, der das Wissen, das er von uns erhält, im Guten verwendet und nicht missbraucht. Es ist einfacher, Einzelne um Hilfe zu bitten als von allen
Menschen gleichzeitig komplette Umkehr zu verlangen. Wir haben dich ausgewählt, weil du dich schon seit Jahren bemühst, mit uns zu sprechen.“
„Danke. Ich hätte nicht gedacht, daß es wirken würde. Und
was kann ich für euch tun?“
„Wir möchten Dir Wissen geben. Hast Du Zeit für uns? Es ist etwas umfangreich.“
„Eigentlich sollte ich jetzt arbeiten gehen. Ich habe einige Termine heute.“
„Dann geh erst arbeiten. Wir haben viel Zeit. Wenn Du fertig bist, gehst Du in den Wald, wo du immer joggst. Auf der Lichtung, an der du manchmal eine Pause machst, steht eine Eiche. Setz Dich unter den Baum, lehne dich an den Stamm.
Wir sind da.“
Er stand auf, nickte und ging langsam Richtung Büro.
Es war ganz und gar unmöglich, was hier geschehen sein soll. Entweder hatte ihn von einem zum andern Tag die Schizophrenie ereilt oder er hatte einen Hirntumor samt Halluzinationen. Je länger das Erlebnis her war, desto unwahrscheinlicher
schien es ihm. Er versuchte zu arbeiten. Arbeit ist etwas Handfestes. Man fängt es an und bringt es zu Ende. Das Produkt ist sichtbar, die Ordner sind gefüllt. Er sprach mit Kollegen über das Wetter, das Kaffeekochen. Alles schien
ihm so normal zu sein.
Manchmal konnte er das Erlebnis minutenlang vergessen, bis es ihm wieder einfiel, und sein Herz zu rasen begann. Darum goß er die halbvolle Tasse Kaffee in den Ausguß der kleinen Bürospüle und
kochte sich Pfefferminztee. Vielleicht beruhigte der ihn.
Das kann man niemandem erzählen, dachte er sich. Die schicken mich in die Klapse, ich verliere meinen Job. Na prima, ich fange schon an zu denken wie meine Mutter.
Als er vom Büro nach Hause ging, wagte er es nicht, die „Jungs“ zu begrüßen. Trotzdem wußte er, dass er gleich in den Wald gehen würde. Wenn etwas an seiner Wahrnehmung stimmte, dann dürfte er die Chance
nicht vergeben, sich zu beweisen, daß er nicht verrückt geworden war. Er zog sich seine Joggingsachen an, band sich die Turnschuhe zu, steckte den Schlüssel ein und trabte los.
Wenigstens sehe ich aus wie ein harmloser Jogger.
Keiner sieht mir an, was ich vorhabe. Wer weiß, was andere Jogger vorhaben? Vielleicht ist heute ein Riesenmeeting unter Bäumen angesagt.
Der Waldboden federte. Er stellte mal wieder fest, daß seine Kondition nicht besonders
gut war, weil er nach 500 m eine Gehpause einlegen mußte. Immerhin war er an der frischen Luft und zeigte seinem Körper den guten Willen, ihn fit halten zu wollen.
Er bog zur Lichtung ein. Sie lag schon im Schatten. Das Gras raschelte um seine Knöchel. Er ging durch späte Mückenschwärme und kniff den Mund zusammen: fürchterliche Vorstellung, so etwas einzuatmen. In seinem Nacken lief der Schweiß unter den Haaren hervor. Der letzte Spaziergänger, dem er begegnet war, lag schon Minuten zurück. Er war allein, ging zur Eiche und setzte sich in eine Wurzelgabel des Baumes, lehnte Rücken und Kopf an den Stamm und atmete heftig aus.
„Gut, Leute, hier bin ich. Sagt mir vor allem, daß ich nicht spinne!“
Es war still. Er hörte die Äste im Wind knarren, die Blätter raschelten und eines fiel vor seine Füße. Er nahm es in die Hand und
roch daran.
„Schön, daß du da bist!“
Er fuhr herum und ließ das Blatt fallen. Kein Mensch war zu sehen.
„Nimm das Blatt ruhig wieder in die Hand, es ist ein Gruß.“
Er versuchte,
gleichmäßig zu atmen und nahm das Blatt wieder auf.
„Tut uns leid, daß wir dich so verwirren. Leider geht es nicht anders. Früher war es leichter, mit Euch zu reden. Du spinnst nicht, können wir dir sagen,
wenn dir das hilft.“
„Na, wenigstens etwas. Könnt Ihr euch vorstellen, was für einen Schrecken ihr mir einjagt?“
„Wir spüren es, Dein Herz rast, du atmest zu schnell. Wir werden versuchen, Dir
Ruhe zu vermitteln, damit du besser zuhören kannst. Lehne deinen Rücken fest an den Stamm.“
Plötzlich spürte er Ausgeglichenheit, sein Körper entspannte sich. Er war nicht müde, er war hellwach. Trotz der niedrigen Temperatur im herbstlichen Wald war ihm nicht zu kühl. Er meinte zu merken, wie im Stamm des Baumes, die Säfte hochstiegen. Er fühlte sich, als habe er Zweige und Blätter, die an seinen Fingerspitzen wuchsen. Seine Füße verbanden sich mit der Erde und bekamen tiefen Halt. Es verwirrte ihn nicht, sondern gab ihm das Gefühl, dass er Teil dieser Lichtung wurde.
„Hey, das tut gut!“
„Bitte, keine Ursache.“
„Man sollte öfters Bäume umarmen.“
„Allerdings! Bist Du bereit?“
„Ich denke schon, legt los!“
„Wir
machen uns um Euch Sorgen. Es macht uns zwar nichts aus, daß wir Bäume weniger werden, aber das Gleichgewicht zwischen uns und euch stimmt nicht mehr. Es wird Zeit etwas zu tun.“
„Das ist nichts Neues. Ihr habt bestimmt
schon von Greenpeace gehört und von den Leuten, die auf Bäumen wohnen, damit sie nicht gefällt werden.“
„Ja, das ist gut. Es hilft aber euch und uns nicht viel. Wir Pflanzendinge sind seit langer Zeit in die Passivität zurückgezogen. Wir lassen die Welt geschehen. Früher war das gut so. Es hatte alles seinen Rhythmus,
Kommen und Gehen, Wachsen und Zerfallen. Jetzt scheint es alles zu Ende zu gehen. Und bevor wir zu wenige werden, müssen wir handeln. Im Prinzip könnten wir mit einigen gezielten Aktionen uns die Erde zurückerobern, aber darüber
sind wir uns nicht einig.“
„Gibt’s bei Euch etwa auch Demokratie. Diskutiert ihr?“
„Natürlich, was glaubst du?“
„Ich habe mir das Pflanzenreich irgendwie eher als eine Art Königtum
vorgestellt, in dem die Herrscherbaum den Laden regelt.“
„Yggdrasil vereint nur unsere Stimmen, aber er hört zu, harmonisiert die Anliegen. Stell Dir einfach vor, wir hätten auch einen Bundeskanzler.“
„Ha,
Gerhard Schröder als Kastanie der SPD. Aber vermutlich gibt’s bei Euch nur Grüne.“
„Die Vergleiche hinken, aber es paßt. Wir nehmen sozusagen die diplomatischen Beziehungen wieder auf zu einem Land, mit
dem wir lange nicht mehr Kontakt hatten. Betrachte dich einfach als ernannter Botschafter.“
„Hey, mit meiner Karriere geht es steil bergauf.“
„Wie jeder bessere Job wird auch dieser seine Schattenseiten haben,
aber du darfst die Ernennung gern etwas genießen. Einige von uns sind durchaus dafür, nicht mehr mit den Menschen zu sprechen. Sie möchten all das Menschenwerk unter einem tüchtigen Schub Grün verschwinden lassen und
den Spielraum der Menschen in eine Zeit zurückdrehen, wo man einen Baum fragte, bevor man ihn fällte, und man ihn nur darum fällte, weil man ein Haus, Möbel und Brennholz brauchte.“
„Wart ihr denn mit dem
Bäumefällen einverstanden?“
„Wir konnten es gut vertragen, es war nötig. Die Menschen haben uns zu diesen Zeiten auch Gutes getan. Wird ein Baum gefällt geht seine Seele – das was ihr Seele nennen würdet
– in andere Bäume ein. Er bleibt ein Teil von uns, nichts geht verloren.“
„Ich habe keine Ahnung, was ich tun kann. Ich bin nicht besonders einflußreich und jede Aktion, die ich mir praktisch oder politisch vorstellen
könnte, war entweder schon mal da oder hat kaum Wirkung gehabt. Ich hätte ein paar Naturfreaks, ein paar Vegetarier und Frutarier auf meiner Seite und eine Menge höchst amüsierter Leute würden sich das Spektakel anschauen.“
„Frutarier?“
„Ihr habt kein Fernsehen, was? Schon mal den Film „Notting Hill“ gesehen? Da versucht Hugh Grant die Liebe seines Lebens, Julia Roberts, zu vergessen und trifft sich mit einigen Frauen, die alle irgendeinen seltsamen Kick
haben. Eine davon ist Frutarierin. Die essen nur das, was die Pflanzen freiwillig hergeben, heruntergefallene Früchte und so was. Und darum ißt sie die gekochten Karotten nicht, weil die angeblich ermordet wurden.“
„Interessante
Betrachtungsweise. Das haben wir aber nie in die Welt gesetzt. Wir sind immer bereit, Euch und die Tiere zu ernähren. Frutarier! Das werde ich den andern erzählen. Ist mal ein neuer Witz!“
„Seltsame Vorstellung, daß ein Baum dem anderen einen Witz erzählt: ‚Kommt ein Baum zum Arzt...’“
„Sagen wir mal so, ich brauche ihn nicht zu erzählen, weil wir Dir alle zuhören.“
„Alle Bäume auf einmal?“
„Alle auf einmal.“
„Wow. Die größte Menge Menschen, vor der ich mal gesprochen habe, waren etwa 1000. Aber das war keine Unterhaltung, sondern ein Vortrag... Sagt
mal, warum seid Ihr so locker? Ich glaube ja nicht, daß es hier um Cocktailparty-Konversation geht.“
„Wir benutzen Deinen Denk- und Sprechstil, damit Du uns verstehst. Wir glauben, daß sich hinter Deiner flapsigen
Sprache durchaus Ernst verbirgt, aber du wagst nicht, ernst zu sein, weil du glaubst, dann langweilig zu wirken. Aber du wagst es, wenn es locker rüberkommt, Dinge zu erzählen, die selten jemand ausspricht. Du überspringst damit
die Grenzen von üblichem Anstand und normaler Logik. Gerade darum glauben wir, daß Du der Richtige bist.“
Er schwieg erstaunt. Selten hatte ihn jemand so durchschaut.
„Welche Baumart ist Dein Lieblingsbaum?“
„Ist das eine Fangfrage? Kriege ich von allen anderen jetzt eins übergebraten?“
„Unsinn!
Wir sind weder bösartig noch intrigant. Es war eine echte Frage!“
„Also gut. Ich habe mir noch nie überlegt, welche Baumart ich besonders mag. Ich mag an jedem etwas anderes. Birken sind unglaublich fragil, sie kommen mir vor wie junge Mädchen und wirken hell. Es gibt einen zartblättrigen
Ahorn, der im Herbt Farben entwickelt, die zum Heulen schön sind. Eichen sind kraftvoll, sind mir aber zu deutsch, dafür können die Eichen aber nichts. Aus Weidenzweigen hat mir mein Vater immer Flöten geschnitzt. Kastanien
habe ich gern in meiner Nähe, weil sie so mächtig und heiter zugleich wirken. Ich habe als Kind im Herbst in Bergen von Kastanienlaub regelrecht gebadet. Alle Obstbäume sind liebevoll, das liegt wohl daran, daß ich es mag,
weil wir die Früchte bekommen. Ein blühender Flieder im Mai macht mich regelrecht betrunken durch seinen Duft. Seit ich „Stein und Flöte“ gelesen habe, mag ich Ebereschen besonders. Der Flöter hat darin einen sprechenden
Stock aus Ebereschenholz bekommen, den er Zwirbel nannte. Muß ich mich entscheiden?“
„Das wäre uns wichtig.“
„Also gut. Ohne einen von Euch beleidigen zu wollen, ich nehme die Eberesche.“
Kaum hatte er das gesagt, spürte er wie er seinen physischen Körper verließ. Er flog durch etwas, das ihm zeit- und raumlos erschien. Es machte ihm Angst und Mut zugleich. Die „Landung“ erschien ihm, als flösse er in etwas hinein. Er war auf einem Berg angekommen. Auf dem runden Gipfel stand eine Gruppe Ebereschen. Er war in ihnen. Es spürte die feuchte, fruchtbare Erde, in der die Wurzeln steckten. Der Wind bewegte seine Blätter. Die hellroten Beerentrauben wogten aneinander und gaben zarte Klänge von sich wie ein Glockenspiel. Die Äste und Zweige schwangen sich dem Himmel und der Sonne entgegen in einem fortwährenden Tanz. Er spürte wie alle Bäume miteinander verbunden waren. Es klang wie Grundakkorde eines Liedes, in dem es um ein ewiges Werden und Vergehen ging, um Wasser und Licht, Säen und Ernten. Kein Baum, der jemals verging, war verloren, er ging in den anderen auf. Sie alle waren ‚der Baum’.
Das Lied der Bäume erhielt zusätzliche Melodiestränge. Er spürte wie sich die Bäume seit Urzeiten dem Menschen verbanden, wie sie ihn schützten und ernährten, ihr Holz freundlich für Bau und Feuer hergaben. Und immer sprachen sie zu den Menschen, wenn die Holzscheite im Ofen knisterten, wenn hölzerne Zaunpfähle tatsächlich ein ‚willkommen’ winkten, wenn die geschwungene Armlehne eines Sessels sich der Hand, die ihn umfaßte, anvertraute. Aber kaum einer hörte sie sprechen.
Ein weiterer Melodiestrang zog sich besorgt durch das Lied. Er sprach vom Vergehen der großen Wälder, von asphaltierten Flächen, von Luftmangel und Gift, das im Regen herabfiel. Aber es war keine Sorge der Bäume um ihretwillen darin, sondern um der Menschen willen. Das wunderte ihn, denn als Mensch hätte er Angst vor dem Vergehen der Menschheit. Die Bäume aber sahen alles mit Gleichmut. Selbst wenn der letzte Baum auf Erden verschwunden wäre, würde es „die Baumheit“ geben. Das Baumbewußtsein wäre immer da.
Was zu fehlen schien, war das Gesamtbewußtsein des Menschseins. Es schien, als gäbe es Millionen und Abermillionen von einzelnen Bewußtseinszuständen zu geben, die wenigsten waren miteinander verbunden oder harmonisiert. Wenn das Gesamtbewußtsein der Bäume als Musik zu beschreiben wäre, dann würde es ein Lied sein, die „Musik“ der Menschen war eine lärmende Kakophonie.
Es erschreckte ihn, das alles wahrzunehmen und begann die Sorge der Bäume um die Menschen zu verstehen. Nicht die Bäume standen vor dem Untergang, obwohl sie immer weniger wurden, nein, die Menschen schienen dem Untergang geweiht.
Zugleich fühlte er sich unglaublich wohl in seinem Miteinander mit der Eberesche. Heiterer Gleichmut, liebevolle Gedanken und tiefes Vertrauen erfüllten ihn. Er fühlte sich nicht allein, obwohl er sozusagen im Körper eines
einzigen Baumes ruhte. Alle waren da, mit ihm verbunden. Er war Teil von allem, was existierte. Es war egal, was mit ihm passierte. Mochte ihn der Wind oder eine Axt fällen, er würde nie vergehen. Das was Baum an ihm war und Baumbewußtsein,
würde für alle Ewigkeit fortbestehen.
Mit diesen Gedanken endete sein Besuch bei den Ebereschen und er wurde zurück in seinen Körper gesogen. Inzwischen war es dunkel geworden. Jetzt fröstelte ihn.
„Wir vermuten, daß Du für’s Erste bedient bist, um es mit deinen Worten zu sagen.“
„Allerdings. Es ist vor allem recht unangenehm, in diesen begrenzten Körper zurückzukehren, nachdem ich
gerade so herrlich mit allem verbunden war.“
„Du bist nicht begrenzt. Deine Vernunft, deine Vorstellungen begrenzen dich. Auch ihr Menschen könntet verbunden sein. Wenn wir Bäume es können, um wieviel mehr müßtet
ihr es hinbekommen. Begrenzung ist eine Illusion. Nun geh nach Hause. Wir rufen Dich, wenn das Programm weitergeht.“
„Das Programm?“
„Fernsehtechnisch für Menschen gesprochen. Betrachte es als Pause, bis
der nächste Film läuft.“
„Ihr seid wirklich überraschend. Außerdem... wollte ich mich bedanken. Es war absolut großartig, was ich erleben durfte. Selbst wenn es mir nie wieder passieren sollte, würde
ich mein Leben lang darüber nachdenken können. Danke, daß ihr mich herausgesucht habt.“
„Dankbarkeit ist der Anfang des Glücks. Roger and over.“
Leseprobe II:
Kaloum war erschöpft. Er verabschiedete sich vom Teich und wandte sich heimwärts. In einer kleinen Senke hörte er Rascheln im Unterholz.
„Wer ist da?“ rief er in das dunkle Gestrüpp.
Aus dem dichten Dickicht
trat mir überraschender Behendigkeit ein Wesen, das er auf den ersten Blick als Troll oder Kobold aus einem Märchenbuch bezeichnen würde. Es war umwickelt von Efeuranken, Blättern und Zweigen. Es schien regelrecht daraus zu
bestehen. Und obwohl es kaum einen Meter groß war, versperrte es ihm den Weg und baute sich vor ihm auf.
„Na, wer schon, du trampelfüßiger Erdling? Ich bin der Grüne.“
Wenn Kaloum nicht wegen dieser
groben Ansprache etwas ängstlich geworden wäre, hätte er sich getraut zu frage, ob es auch einen Blauen, Gelben oder Roten gegeben hätte.
„Wage es nicht, mich zu verspotten, Klumpfuß.“
„Ich
habe garnichts gesagt!“
„Aber von Deinen Gedanken hallt der Wald wider wie von einer Blaskapelle. Ich bin wahrlich nicht freiwillig hier. Die Bäume haben jedoch beschlossen, dich zum Botschafter zu machen. Ist schon eine
Weile her, dass ich mit Deinesgleichen sprechen mußte. Ihr seid lärmig, dumm und grob. Sei’s drum. Ich bin der Abgesandte des Kleinen Volkes.“
Kaloum war verdattert. „Wer ist das Kleine Volk?“
„Ich
sag’s ja. Nicht für ein Staubkorn Verstand ist bei Euch zu finden. Das Kleine Volk, nun denn. Ihr habt Euch Namen für uns ausgedacht: Zwerge, Trolle, Elfen, Feen. Gibt’s nicht genug über uns zu lesen? Haben nicht einige
von Euren Humpeltretern genug Erfahrungen mit uns gemacht, um Bücher zu füllen.“
„Ja, schon, aber das sind doch eher Märchen oder Fantasy gewesen.“
„Wirklich außerordentlich beschränkt,
wie ihr euch eure Wirklichkeit bastelt. Ihr habt eure Köpfe auch nur zum Haarekämmen, was?“
„Sag mal, wenn alles eins ist, wieso benimmst du dich nicht auch so sanftmütig, als wärest du mit mir verbunden?“
„Meine Güte, auch noch Ansprüche stellen. Ich kann mir wahrlich etwas Besseres vorstellen als mit Dir verbunden zu sein. Wirklich, ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, warum sie gerade dich ausgewählt haben. Du bist
ein Sauertopf von einem Erdling wie alle. Wenn sich Euer Hochwohlgeboren nun herablassen könnten, mir zu folgen, damit wir nicht unsere Zeit auf einem Menschenpfad vertändeln...“
„Folgen? Ich dachte, ich gehe nach Hause?“
„Donner und Blitz, manchmal ändert sich eben der Stundenplan. Wir unterhalten uns hier nicht darüber, ob Du das willst, sondern nur noch, wie lange wir hier noch herumstehen müssen.“
Kaloum zuckte mit den Schultern
und nickte. Es war wohl unausweichlich.
„Halte Dich an einer meiner Ranken fest, damit du nicht verloren gehst.“
Kaloum ergriff den Efeu und wurde vom Grünen erbarmungslos in das Dickicht geschleppt. Zweige schlugen
ihm ins Gesicht, dornige Sträucher klammerten sich an seine Hose. Er schien im tiefsten Dschungel gelandet zu sein. Atemlos hetzte er hinter dem Grünen her, bis sie schlißlich vor einem mächtigen Baum standen.
„Sing!“
befahl der Grüne
„Was?“
„Ich sag, du sollst singen, zum Donnerwetter!“
„Warum?“
„Damit die vermaleideite Tür aufgeht, du luftschnappender Weichling.“
„Welche Tür?“
„Beim Geweih meiner Großmutter. Euch muß man alles erklären. Wenn ein Erdling zu uns
kommt, muß er sich in unser Reich hineinsingen. Ich komme natürlich wesentlich einfacher hinein, aber euresgleichen braucht einen Türöffner. Sing!“
„Was Spezielles?“
„Nein, du aufrecht gehendes
Stück Hundescheiße. Sing, was dir gerade einfällt. Zeckenbiss und Flohstich, da behauptet Ihr, die Musikalität gepachtet zu haben und kniet vor einem Herrn Beethoven oder Whitney Houston nieder, und dann sowas. Sing endlich,
ich will nach Hause.“
Kaloums Gehirn schien – rein musikmäßig betrachtet – zur Wüste zu werden. Ihm fiel nichts Gescheites ein. Alle meine Entchen’ erschien ihm zu trivial. Als der Grüne kurz
vor einem Tobsuchtsanfall zu stehen schien, entschied er sich für Bruder Jakob’. Seine Stimme zitterte sich durch die ersten Takte. Vollkommen idiotisch, mit einer Art Zwerg im Wald zu stehen und singen zu müssen.
„Na, endlich,“ grummelte der Grüne. Der Baum öffnete seinen Stamm zu einem breiten Portal, durch das die beiden mühelos hindurchpassten. Eine Treppe, die mit Pechfackeln beleuchtet war, führte ins Erdreich hinunter. Leichtfüßig und lautlos huschte der Grüne die Treppe hinunter und nahm immer zwei Stufen auf einmal. Kaloum folgte ihm und hörte das Hallen seiner Schritte. Als sie endlich auf einer tieferen Ebene angekommen waren, führte ihn der Grüne durch verzweigte Gänge, die sich durch die Wurzeln des mächtigen Baumes schlängelten. Kaloum gab auf, sich den Rückweg merken zu wollen. Schließlich wurde es heller und sie standen in einer Art Halle. Kaloum hörte Stimmen, Gesang und seltsame Töne. Der Grüne stieß eine große Holztür auf, die Kaloum gar nicht wahrgenommen hatte. Eine riesiger Saal tat sich auf. Er wirkte wie ein gigantisches Wohnzimmer von jemandem, dessen Lieblingsfarbe Grün war. Grüne Sofas, die aus Blättern geflochten zu sein schienen, Hängematten aus Lianen, Sessel, die mit Gras bezogen waren, Bäume, die wie Tische gewachsen waren. Und überall saßen, standen, tanzten die Artgenossen des Grünen, es mußten Hunderte sein. Als er genauer hinsah, entdeckte er auch andere Sorten von Wesen: große, kleine, zarte Gestalten, die geradezu durchsichtig wirkten, geflügelte Wesen, triefnasse Gestalten. Es waren zu viele, um sich ein Bild zu machen. Der Grüne nahm ein grünes Weinglas vom Tisch, zog einen Schlüssel aus seiner Hosentasche und schlug gegen das Glas. Statt einen üblichen einzelnen Ton von sich zu geben, spielte das Glas eine komplette Melodie von filigraner Schönheit. Augenblicklich verstummte das Gemurmel im Saal und alle blickten zu den beiden Neuankömmlingen.
„Leute,“ begann der Grüne, „es ist mal wieder soweit. Wie schon angesagt, haben wir heute Besuch von einem Erdling. Er heißt Kaloum und wurde zum Botschafter ernannt. Also, müssen wir mal wieder alles aufrollen, damit der Botschafter seine Lektion ordentlich lernt. Ich weiß, dass das bei Euch und bei mir natürlich auch keine Begeisterungsstürme auslöst, aber je eher wird es hinter uns bringen, desto schneller sind wir ihn wieder los. Zumindest haben wir ihn jetzt in unserer Gewalt und können ihn ruhigstellen.“
Kaloum hatte das ungute Gefühl, eine Geisel zu sein. Er versuchte, langsam zu atmen, um seine Angst zu bewältigen. Der Grüne zog ihn hinter sich her. „Ich stell dir jetzt mal ein paar von uns vor.“
Zunächst blieb er vor einem dieser triefnassen Wesen stehen, die aus Algen, Tang und Sumpfgras zu bestehen schien. „Ein Schlämmling!“ sagte er. Kaloum versuchte freundlich zu nicken und herauszufinden, wo vorne und hinten, wo
Augen, Mund oder Hände dieses Wesens waren. „Mit Schlämmlingen ist nicht zu spaßen. Sie klammern sich gern mal am Bein eines unvorsichtigen Schwimmers fest. Aber wenn man nicht gerade einen hübschen, ruhigen See mit
einem Bagger umpflügt, sind sie eigentlich recht verträglich.“
Als nächstes blieb er vor einem dünnen Ast stehen, der wie ein Stock an die Wand gelehnt war. Der Ast begann sich zu bewegen und zerwühlte mit
einem seiner beblätterten Zweige Kaloums Haar. „Ein Holzmännchen, außerordentlich häufige Spezies, die Wälder sind voll davon. Was Holzmännchen auf den Tod nicht ausstehen können, ist, wenn sie jemand
für einen herumliegenden Ast hält. Da werden sie total knüppelig. Keine schöne Erfahrung.“
Eine libellenartige Frauengestalt, kaum größer als eine Amsel, kicherte, als der Grüne zu ihr kam. „Ein Flattermädchen, äußerst pubertär im Verhalten, nicht besonders ernsthaft. Gehen gern im Sturzflug schwarmweise auf Spaziergänger nieder.“
Von einem Tisch ergriff der Grüne wahllos eins der herumstehenden grünen Gläser. Es schien aus grüner Flüssigkeit zu bestehen, die Form blieb bestehen, aber die Farbe überzog wellenartig das Gefäß. „Ein Singglas. Sehr unterhaltsam und zugleich praktisch für jede Sorte Getränk. Verführt oft zu Trunkenheit. Es ist außerdem immer voll und selbstreinigend.“ Als er es zum Mund führte begann das Glas, eine zarte Musik zu spielen und sang mit einem feinen Sopran eine Melodie dazu. Als er es absetzte, verstummte es.
„Der hier gehört zur Sorte der Plautzentrolle. Überaus verfressene Gattung, aber keine Sorge, er fällt keine Erdlinge an. Da da drüben ist ein Leuchtkerl, er hat keine Ahnung, was Finsternis ist. Tagsüber fühlt er sich von der Sonne beleidigt, darum ist er nachts unterwegs. Falls man mal wirklich schlechter Laune ist, sollte man die Lachmuschel aufsuchen. Sie hat klare Sprechstunden. Den Rest ihrer Zeit braucht sie, um sich selbst Witze zu erzählen. Die Wolkenkissen erfreuen sich grosser Beliebtheit, vor allem, wenn man müde ist und es bequem haben will. Wenn sie einen guten Tag haben, summen sie einen sogar in den Schlaf. Paddelfritschen treten meistens paarweise auf. Sie sind freundschaftlich eng mit den Flapsbooten verbunden, weil sie dann gemeinsam auf dem Wasser vorwärts kommen. Das Sitzgras hat sich für Erscheinungformen entschieden, die uns recht bequem sind, es taucht als Sessel, Hängematte oder Sofa auf. Wenn sie schlecht gelaunt sind, dann erkennt man das daran, dass sie die Form eines Hockers oder Schemels einnehmen. Dann sollte man sie in Ruhe lassen. Das hier ist ein Holztisch. Seine Art ist äußerst sensibel, denn es kommt leicht zu unangenehmen Verwechslungen mit dem, was Erdlinge unter Tischen verstehen. Die Konzertfrieda ist zuständig für die Imitation jeder Art von Wald- und Wiesengeräuschen. Die Pilzhummel neckt Pilzsammler gern mit einer Darstellung von Pilzen, wobei sie im letzten Moment immer davonfliegt. Das Rabenaas hat leider kaum gute Eigenschaften, aber man kann es prima seinen Feinden auf den Hals hetzen.“
Kaloum wurde regelrecht schwindlig von dieser Aufzählung. Es folgten noch einige, bis der Grüne ihn endlich aufforderte, auf einem Sitzgras in einer Runde von Wesen Platz zu nehmen. Ihm wurde ein Singglas mit einer hellen Flüssigkeit
vorgesetzt.
„Kommen wir zu den eher klassischen Vertretern. Darf ich vorstellen: Zwerg, Troll und Elfe, Waldschrat, Gnom, Buschgeist und Nymphe. Meine Wenigkeit heißt einfach der Grüne, ich bin so eine Art Präsident und kann jede
der vorgestellten Formen annehmen. Nun erheben wir das Singglas auf das Wohl unseres Gastes, möge er gescheiter werden als er ist, möge uns seine Dummheit nicht ärgern, Gesundheit und Wohlleben für uns, und dass uns die Erdlinge
für lange Zeit danach wieder fernbleiben.“ Die Singgläser begannen beim gemeinsamen Trinken mit einem vielstimmigen Konzert. Sie brachten sogar einen harmonischen Schlußakkord zustande, als alle ihre Gläser absetzten.
Das Getränk war leicht, enthielt offensichtlich Alkohol, prickelte zart auf der Zunge und war von vollendetem Geschmack. „Was ist das?“ fragte Kaloum. „Das,“ antwortete der Waldschrat, „ist Saladu. Es passt sich
der Geschmacksvorliebe des Trinkenden an. Kann also gut sein, dass in deinem Glas etwas anderes drin ist als in meinem. Außerdem kann man mit einem Gedanken vor dem Trinken bestimmen, wie es wirken soll: belebend, einschläfernd, erheiternd,
melancholisch. Da du keinen Gedanken vor dem Trinken fassen konntest, haben wir das für dich getan. Wir haben beschlossen, dass es lähmende Müdigkeit verursachen soll, da wir dich dann leichter handhaben können.“
Kaloum spürte augenblicklich tiefe Erschöpfung und konnte kaum die Augen offen halten. Komischerweise war er wach genug, alles um sich herum wahrzunehmen, aber er war zu schwach, um sich zu äußern, geschweige denn, um das Singglas
zum Mund zu führen, um sich eine andere Wirkung zu wünschen. Seine Tischgesellschaft stand lärmend auf. Der Buschgeist klemmte ihn sich wie ein Bündel Holz unter den Arm und trug ihn aus dem Saal. Der Troll, der Grüne
und der Zwerg begleiteten ihn. Sie stiegen viele Treppen hinunter, bis zu einer Tür. Dahinter befand sich eine Art Verlies, eingerichtet mit einem völlig vertrockneten Sitzgras in Form eines Hockers, einem farblosen Singglas und einem
fast verloschenen Leuchtmännchen. Kaloum wurde unsanft abgesetzt, die Tür verschlossen und er war allein. Trotz der mißlichen Situation war er unfähig sich zu rühren. Er schlief auf der Stelle an, ohne einen klaren Gedanken
fassen zu können.

Kurzbeschreibung zu „Die Männerflüsterin“:
Männer,
seid ganz Auge und Ohr, denn hier flüstert euch die Frau endlich die Geheimnisse zu, die zum Ende des Geschlechterkampfs führen werden.
Ihr braucht keine Psychologiewälzer zu lesen, sondern nur diese läppischen
111 Regeln zu beherzigen, und das weite Land des Beziehungsglücks liegt offen vor euch.
Leseprobe:
Kapitel 1
Der weibliche Körper
ist eine einzige Problemzone
> 1 Egal, welche Figur wir haben, sie ist ein
Problem. Wenn wir uns nicht an den Models aus
der BRIGITTE orientieren, dann doch zumindest
daran, wie wir vor 10, 15, 20 oder mehr Jahren mal
aussahen und wieder
aussehen wollen.
> 2 Der Satz: „Ich liebe Dich so wie Du bist“,
ist zwar schon recht feinfühlig, aber noch nicht
ganz das, was wir hören wollen.
Die Komplimente müssen jeweils im Einzelfall
und das täglich
ausgesprochen werden,
z.B. „Diese Farben stehen Dir total gut. Das Jackett
finde ich sexy. Deine Beine sehen bei diesem Minirock
Klasse aus. Ich könnte Dich so....“ (aber bitte
nicht, wenn wir gerade gestylt
sind, sonst ist die
ganze Restauration für die Katz gewesen.
Ein mit Worten angedeuteter Geschlechtsakt ist
so viel wert wie ein vollzogener (wenn es nicht
gerade Samstag oder Sonntag ist, und wir wirklich
Zeit
und Lust haben).
> 3 Lasst es zu, dass wir Diät machen und Euch
gleichzeitig eine Soße mit Sahne über die Nudeln
kippen, während wir Möhren mümmeln.
Ein Mann mit Bäuchlein geht weniger fremd.
Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
> 4 Eure ungeschminkte Frau ist „natürlich“ (Textvorgabe),
Eure geschminkte Frau „sieht toll aus“
(dito). Jedes Stadium der Restauration braucht Zeit,
jede Phase (z.B. Sich-gehen-Lassen
im Urlaub)
bringt einen anderen Aspekt unserer natürlichen
Schönheit zum Ausdruck.
Wenn Euch kein Text einfällt, helfen wir Euch gern
mit Textmodulen aus, die uns gefallen, fragt einfach.
> 5 Ein Friseurbesuch ist eine vergleichbar preiswerte
Alternative zu anderen Wellness-Formen,
zu psychotherapeutischen Sitzungen, zu Kosmetikerinnen-
Besuchen.
Friseur ist Erholung, Entspanung, Hingabe.
Wenn wir aber gelegentlich Wert auf teurere Alternativen
legen, lasst es uns tun. Wir sind hinterher
besser gelaunt.
> 6 Lasst uns Euch die Haare schneiden.
So schwer kann das nicht sein. Wir investieren das
Gesparte dann in unseren Friseurbesuch.
> 7 Geht zusammen mit uns ins Fitness-Studio,
damit wir uns vor diesen sportlichen, durchgestylten
Weibern nicht fürchten müssen, die Euch auf der
Drückbank ein Äuglein kniepen.
> 8 Wir sind 39, wenn Ihr 39 seid. Wir sind 39,
wenn Ihr 49 seid, wir sind 39, wenn Ihr 59 seid.
Alles klar? Es gibt aber auch Frauen, die in Würde
altern können.
Stellt Euch auf das Jeweilige ein.
> 9 Sagt, dass die Häufigkeit von Sex in unserer
Beziehung völlig ok ist und alle anderen nur das
Blaue vom Himmel herunterlügen, sofern sie sich
nicht gerade erst verliebt haben.
Wenn Ihr Euch
schon zusätzlich einen runterholen
müsst, dann behauptet, dass ihr dabei an uns denkt,
sofern wir es mitbekommen.
> 10 Kein Sex ist genauso so schlimm wie zuviel
Sex. Exkurs zur Güte: Letztlich haben die Frauen
doch die gleichen Ängste: langweilig, leidenschaftslos,
08/15 zu sein und ihren Männern nicht zu
genügen.
Kurzbeschreibung zu „Die Paeonias Geheimnis“ :
Ein halbes Jahr 'Auszeit' steht der jungen Emma bevor, die sie eigentlich für eine Kur nutzen sollte. Statt dessen wagt sie, das Angebot einer älteren Dame anzunehmen, die auf Reisen geht: Sie wird deren Haus und Garten auf dem Lande hüten.
Emma entdeckt ein seltsames Buch, und die Pflanzen in Paeonias Garten benehmen sich merkwürdig. Sie dringt immer tiefer in das Geheimnis ihrer neuen Umgebung ein und findet eine bisher verborgene Welt.
Mit der Zeit wird ihr klar, was die Geschehnisse für sie bedeuten ...
... und die Post bringt nicht nur Briefe in ihr Leben.
Leseprobe:
„Ja, ich bin gerade angekommen, das Taxi ist eben weggefahren. Es hat eine Stange Geld gekostet. Und eigentlich würde ich am liebsten umkehren und wieder nach Hause fahren. Das war eine Schnapsidee,“ bekannte Emma ihrer Freundin am
Telefon.
„... na, was werde ich wohl tun? Auspacken, mir das Haus ansehen und einmal durch den Garten stiefeln, bevor es dunkel wird. Hier ist die toteste Hose, die du dir vorstellen kannst, und ich habe nicht mal ein Auto. Hoffentlich steht
ein Fahrrad im Schuppen, damit ich zum Einkaufen fahren kann... Okay, lass uns morgen wieder telefonieren. Du bist meine Verbindung zur Außenwelt. Also bleib mir treu und halte mich auf dem Laufenden. Vergiss nicht, meine Blumen zu gießen...
Ja, ja, ich weiß, das habe ich schon gesagt, aber ich sag’s halt noch mal. Gut, tschüss.“
Emma hängte ihre Jacke an die Garderobe. Sie stand unschlüssig im Flur herum. Das war schon eine seltsame Geschichte. Zuerst war die Krankschreibung für ein halbes Jahr gekommen. Emma fand die Kombination ihrer „Zipperlein“, wie sie es nannte, nicht so schlimm, dass es zu dieser Auszeit hätte kommen müssen, aber ihr Hausarzt war komplett anderer Meinung gewesen. Er wollte sie eigentlich in eine Art Sanatorium schicken. Emma sah sich schon auf Thomas Manns „Zauberberg“ veröden, mit all den anderen siechenden Menschen um sich herum. Gut, zugegeben, der Job war in letzter Zeit extrem belastend gewesen, aber das war nichts Neues. Obwohl er wahrlich nicht der Typ dafür war, hatte ihr Chef nicht über die lange Krankschreibung gemeckert. Eine Kollegin aus einer anderen Abteilung würde sie vertreten. Allein das machte ihr schon Bauchschmerzen. Die würde ihr ganzes Büro durcheinander bringen, oder sie käme auf derartig gute Ideen, dass Emma nach diesem halben Jahr abgemeldet wäre oder alles anders machen müsste. Okay, spätere Sorge, jetzt erst einmal nicht an die Zukunft denken.
Dann war der denkwürdige Abend gekommen, als sie gegen ihre Gewohnheit den Reiseteil der Tageszeitung gelesen hatte. Unter den vielen Kleinanzeigen entdeckte sie eine besondere: „Pflege für kleines Haus mit Garten auf dem Lande gesucht wegen halbjähriger Weltreise, ab 15. März. Chiffrenummer C 33 777 59.“ Irgendetwas reizte Emma daran, und sie antwortete darauf. Die Dame, der das Haus gehörte, hatte sich per Email bei ihr zurückgemeldet. Es hatte wohl einige Bewerber gegeben, aber Emma schien ihr zu gefallen. In ihrer Email-Korrespondenz ging es kaum um das Haus und den Garten, eher um Kinofilme, Literatur und Lieblingsfarben. Die Dame, deren Namen in der Emailadresse „Paeonia“ lautete - und Emma vertippte sich stets dabei – hatte ihr einfach mitgeteilt, dass sie einen kleinen monatlichen Betrag an Emma überweisen würde, damit sie Haus und Garten in Schuss hielte, sowie Telefon- und Stromkosten übernehmen würde, bis sie von ihrer Reise zurück käme. Der Rest würde sich einfach finden. Ihr Hausarzt hatte sich darauf eingelassen, dass dort nun Emmas Kurort wäre, hatte einen Kollegen vor Ort angerufen und Emmas Unterlagen hingeschickt.
Und nun war sie da. Das Haus lag einsam zwischen zwei Dörfern, deren Namen Emma auf der Landkarte nicht einmal gefunden hatte. Die nächste ernst zu nehmende Stadt war 20 Kilometer entfernt. Emma war elend zumute. Ihre Freundinnen waren weit weg. Sie hatte sich auf etwas eingelassen, von dem sie keine Ahnung hatte, wie es ausgehen würde. Ihr Alltag war mit dem 14. März schlagartig zu Ende gewesen. Der Heldenmut der letzten Zeit hatte sich aufgelöst.
Emma beschloss, sich zuerst das Haus anzusehen. Sie ging vom Flur geradeaus in die Küche. Dort war ein Ausgang zu einer kleinen Naturstein-Terrasse und in den Garten. Die Küche schien in den fünfziger Jahren stehen geblieben zu sein: ein Gasherd mit Backofen, ein Küchenschrank mit kleinen Glasschüben für Mehl, Zucker und was man sonst so braucht, ein kleiner Kühlschrank, der laut summte, ein Holztisch mit zwei Stühlen, auf dem ein Strauß Tulpen stand. An der Vase lehnte ein Umschlag „Für Emma“.
„Liebe Emma,
herzlich willkommen in Ihrem Heim für ein halbes Jahr. Ich freue mich, dass Sie da sind. Das Haus und der Garten freuen sich ebenfalls auf Sie. Ich kann mir vorstellen, wie fremd alles für Sie ist. Nach der ersten
Nacht sieht es sicher schon besser aus. Ich habe Ihnen den Kühlschrank und die Vorratskammer gefüllt. Hoffentlich mögen Sie, was ich für Sie eingekauft habe. Schauen Sie sich ruhig gründlich um. Ich habe keine Geheimnisse.
Ich vertraue Ihnen. Falls Sie Hilfe brauchen, liegt im Flur neben dem Telefon ein Notizblock mit den Telefonnummern von Freunden und Nachbarn, die gerne vorbeikommen oder Sie bei größeren Einkäufen mit dem Auto begleiten. Wenn
Sie Ideen für den Garten haben, scheuen Sie sich nicht, sie umzusetzen. Aber übernehmen Sie sich nicht, denn eigentlich sollen Sie sich hier erholen. Tun Sie nur das, was Ihnen gut tut.
Das Haus wird Sie beschützen, der Garten
wird Ihnen viel geben, das kann ich Ihnen versprechen. Bis zum 15. September werden Sie ein anderer Mensch sein, da bin ich mir ganz sicher. Alles Gute für Sie, Ihre Paeonia“
„Das Haus wird mich beschützen?“ wunderte sich Emma, dachte aber nicht weiter darüber nach.
Tatsächlich: im Kühlschrank gab es Gemüse, Käse, Milch, Butter, Joghurt. Eine Flasche Weißwein und eine Flasche Sekt waren auch dabei. Emma entdeckte den Brotkasten mit frischem Brot und die Vorratskammer neben der Küche war so gut gefüllt, dass sie wochenlang davon leben könnte. Sogar an Schokolade hatte Paeonia gedacht.
Das Wohnzimmer im Erdgeschoss war klein und gemütlich. Unzählige Topfpflanzen machten es regelrecht zu einem Dschungel. „Kein Wunder, dass sie jemanden braucht, der sich darum kümmert,“ murmelte Emma. Vor dem Kamin stand ein Sessel. In der Ecke gegenüber dem Sofa war ein kleiner Fernseher. In einem schönen alten Holzschrank fand Emma eine Musikanlage. „Na, wenigstens hat es sich gelohnt, dass ich meine CDs mitgenommen habe.“
Gegenüber der Treppe zum oberen Stockwerk befand sich ein kleines Bad. Oben waren zwei Zimmer und ein weiteres Bad. Paeonias Schlafzimmer erinnerte Emma an ein Jungmädchenzimmer: Blumentapeten, Blumen-Bettwäsche, alles sehr verspielt. Der Blick ging auf den Garten hinaus. Das andere Zimmer schien für Gäste bestimmt zu sein oder auch als Arbeitszimmer zu dienen. Ein Klappsofa, eine alte Kommode und ein Schreibtisch standen darin.
Emma packte aus. Paeonia hatte sogar Platz in ihren Schränken gemacht, damit Emma ihre Sachen unterbringen konnte. „Na ja, sie wird fast alle ihre Klamotten mitgenommen haben,“ sagte Emma laut und erschrak über ihre eigene Stimme in der Stille. „Jetzt fange ich schon an, Selbstgespräche zu führen wie einsame alte Frauen. Hoffentlich werde ich hier nicht völlig verrückt.“
In der späten Abendsonne trat Emma auf die Terrasse. Rechts war ein kleiner Schuppen. Darin standen – ordentlich aufgereiht – alle denkbaren Gartengeräte, Blumenerde, leere Balkonkästen, Saatgut, tatsächlich ein Fahrrad, Werkzeug und Gartenmöbel samt Sonnenschirm. Unter dem Vordach des Schuppens waren Holzscheite bis zur Decke gestapelt.
Der Garten war etwa 200 Quadratmeter groß. Im hinteren Teil standen offensichtlich drei Obstbäume. Unter einem befanden sich eine kleine gusseiserne Bank und ein dreibeiniger Tisch. Im vorderen Teil des Gartens waren links noch leere Gemüsebeete und rechts wohl die Blumenbeete. Noch war im Vorfrühling nicht viel von den Pflanzen zu sehen. Narzissen und Tulpen hatten schon ihre Blätter hochgereckt. Der Garten war von einem Zaun umgeben, den Emma bei sich „dänisch“ nannte: weiß gestrichene, geschwungene Holzlatten.
„Zeit für eine Zigarette,“ beschloss Emma, ging in den Garten und setzte sich auf die Bank unter den Obstbaum. Es war noch etwas kühl, aber sie würde nicht gleich erfrieren. Sie fand einen kleinen Tontopf, den sie zum Aschenbecher ernannte. Paeonia war sicher Nichtraucherin. Emma liebte das Rauchen. Es war eine siebenminütige Auszeit, eine Ansammlung friedlicher, kreativer Momente. Natürlich war es ungesund, aber so gesehen war vieles ungesund, nur das Rauchen bekam die volle Ächtung ab. Emma regte sich immer auf, wenn in amerikanischen Spielfilmen die Raucher stets die Bösewichte, die psychisch Labilen oder die Asozialen waren. Was wussten die Nichtraucher von den Freuden des Rauchens? Mit einer Zigarette konnte man den Beginn einer Sache einläuten, einen Moment innehalten oder eine Vollendung Revue passieren lassen. Der rauchende Mensch gibt solchen Dingen noch Zeit, die Zigarette verleiht einer Pause die Choreographie. Ein Lungenfacharzt hatte ihr einmal angesichts ihrer – übrigens völlig intakten – Lunge gesagt, die Zigarette stelle eine Atem-Meditation dar, die man auch ‚ohne’ gestalten könnte. Emma hielt nicht viel vom Meditieren. Dafür war sie ein zu unruhiger Geist. In ihre krampfhaft visualisierten Meditationsbilder von großen Bäumen oder karibischen Sandstränden brachen immer Horden von Störern ein: Bauern auf Traktoren beim Pflügen, ein Reisebus voller Engländer mit Liegestühlen und Handtüchern. Emmas beste Meditationen waren bildfrei: ein Lied oder das sture Nachzählen des Atemrhythmus, aber selbst das hielt nicht lange. Emma war Bewegung. Sie fand sogar ihren Namen dynamisch. Sie war schnell in allem, was sie tat. Sie entschied schnell, sie handelte schnell, sie bildete sich schnell eine Meinung, sie war auch bereit, diese schnell wieder zu ändern. Sie hatte Jahre gebraucht, um festzustellen, dass sie es gut fand, und ihr entschlusslose Menschen auf die Nerven gingen. Sie war einfach jemand mit einer höheren Taktung. Es würde sich noch herausstellen, ob ihr schnelleres Leben kürzer als das der Anderen sein würde oder nur voller. Den Vorwurf der Ungeduld ließ sie gelegentlich gelten. Sie wollte alles immer sofort. Manche Dinge brauchten aber zugegebenermaßen Zeit, mussten erst gesät, abgewartet und dann geerntet werden. Mal sehen, vielleicht würde dieser Garten ihr Geduld schenken.
Die Sonne war untergegangen. Der Garten versank in der Dämmerung. Emma ging zurück ins Haus und fragte sich, ob sie in dieser Einsamkeit Angst bekommen würde. Hier draußen könnte ein Kettensägenmörder vorbeikommen, ohne dass jemand etwas mitbekäme. Dieser Gedanke zog zig andere nach sich: Was wäre, wenn sie die Treppe herunterfiele, wenn sie sich aus Versehen im Schuppen einschließen würde oder ohnmächtig in den brennenden Kamin fiele? „Ich brauche den Kettensägenkerl gar nicht. Ich schaffe es vermutlich ganz allein, so viel Angst zu kriegen, dass ich eine 1 A Katastrophe produziere. Nein, Schluss damit. Immerhin lebt Paeonia hier auch schon einige Zeit allein, und offensichtlich geht es ihr gut dabei. Also kriege ich das auch hin.“
Emma beschloss, etwas Bodenständiges zu tun und kümmerte sich um ihr Abendessen. Paeonia war anscheinend kein Fan von Konserven, also war es nicht damit getan, den Inhalt einer Dose in einen Kochtopf zu kippen. Emma betrachtete den Inhalt des Kühlschranks und der Speisekammer und kam auf etwas Simples: Möhren-Kartoffeln-Durcheinander. Sie hatte einen Hang zu breiigen Speisen, wenn es ihr nicht so gut ging. Also schälte sie Möhren und Kartoffeln. Mittendrin klingelte das Telefon.
Emma trocknete sich die Hände ab und fragte sich, wie sie sich am Telefon melden sollte.
„Hallo?“
„Guten Abend, hier ist Margret, eine Nachbarin. Na ja, Nachbarschaft ist hier auf dem Land etwas weitläufiger
gemeint. Ich wollte Sie zumindest am Telefon begrüßen. Sie sind doch Emma?“
„Ja. Das ist nett, dass Sie anrufen. Paeonia hat mir eine Liste mit den Telefonnummern der Nachbarn und Freunde hingelegt, damit ich im Notfall
jemanden anrufen kann.“
„Paeonia? Ach, du liebe Zeit. Typisch Lisbeth. Immer auf dem Blumentrip. Sie behauptet, sie sei früher einmal eine Pflanze gewesen. Offensichtlich ist sie gerade mit ihren Pfingstrosen verbunden.“
„Pfingstrosen?“
„Ja, die Paeonie ist die Pfingstrose.“
„Ach so, jedenfalls lautet so ihre Emailadresse.“
„Na, dann ist es ja verständlich. Jedenfalls hat Lisbeth oder Paeonia gesagt, dass ich ein Auge auf
Sie haben soll. Immerhin ist das für einen Stadtmenschen da draußen erst mal ziemlich einsam.“
„Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, was ich mache, wenn ich die Treppe herunterfalle.“
„Sie fallen nicht, Kindchen. Das Haus passt schon auf Sie auf.“
„Komisch, das hat Paeonia mir auch geschrieben. Was soll das denn heißen?“
„Lisbeth sagt, das Haus hat eine Seele, und zwar
eine gute. Wer für das Haus und den Garten sorgt, für den sorgen die beiden auch.“
„Und was passiert, wenn ich etwas falsch mache? Kriege ich dann Schläge vom Apfelbaum?“
„Nein, so schlimm wird
es nicht. Sie werden es schon herausfinden. Auf jeden Fall brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen oder nachts Angst bekommen.“
„Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das beruhigend oder beunruhigend finden soll.“
„Lassen Sie es einfach so sein, bis Sie sich entschieden haben. Ich wollte Ihnen anbieten, Sie jederzeit mit dem Auto in die Stadt zu fahren, wenn sie einkaufen wollen oder zum Arzt müssen. Ich habe Zeit, ich bin in Pension.“
„Danke, das ist ein prima Angebot. Ich werde bestimmt darauf zurückkommen.“
„Tun Sie das. Wenn es sein muss, auch spontan. Ich mag Überraschungen. Ohne Lisbeth ist es hier überraschungsarm. Lisbeth ist
sehr spontan. Das mit der Reise ging auch holterdiepolter. Und sie war sich so sicher, innerhalb von vier Wochen jemanden zu finden, der auf das Haus und den Garten achtet.“
„Und für mich war es wirklich ein Geschenk des
Himmels.“
„Ja, der liebe Gott tut den ganzen Tag nichts als Fügen. Und was machen Sie gerade?“
„Ich koche mir was.“
„Was gibt’s denn?“
„Möhren-Kartoffeln-Durcheinander.“
„Prima, könnte Lisbeths Idee sein. Machen Sie sich doch den Kamin an. Lisbeth sitzt im Winter immer zum Essen vor dem Kamin.“
„Gute Anregung, danke.“
„Also, Emma, meine Nummer haben Sie ja.
Ich wünsche Ihnen eine ganz besonders erholsame und schöne erste Nacht. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen danach zu Mute ist, jederzeit.“
„Danke, tschüss Margret.“
Emma kehrte zu ihrem Schälwerk zurück. So, so, Paeonia hieß also Lisbeth. Das hätte sie wahrscheinlich spätestens dann herausgefunden, wenn Post ankommen würde. Und das Haus meinte es gut. Immerhin, ein Lichtblick an diesem ersten Abend.
Während das Essen auf dem Herd kochte, holte Emma Holz von draußen und stapelte es im Kamin. Sie hatte wenig Ahnung vom Feuermachen. Zeitungspapier war keines zu finden. Schließlich entdeckte sie ganz außen auf dem Sims des Kamins eine Blechdose mit Anzündern. Als das Feuer so aussah, als würde es halten, schloss Emma das Gitter vor dem Kamin.
Sie setzte sich tatsächlich mit dem Topf auf einem Sofakissen über ihren Knien in den Sessel vor den Kamin. Es wurde herrlich warm. Emmas Gesicht glühte. Sie wusste immer noch nicht, wie sie sich fühlen sollte. Es war so einsam
hier, dass ihr selbst die eigenen Gedanken zu laut waren. Sie schienen in diesem Haus widerzuhallen.
War das nun die Zeit, über alles nachzudenken? Sollte sie jetzt damit anfangen? Ihr Hausarzt hatte jedenfalls dazu geraten.
„Tja, was will ich vom Leben? Glück, Erfolg, Gesundheit? Klingt irgendwie nach Geburtstagsglückwünschen, völlig hohl,“ sinnierte Emma. „Eigentlich will ich Erfüllung. Es braucht nichts Besonderes zu sein.
Aber es soll mich zutiefst befriedigen. Dann könnte ich mich mit den übrigen Mittelmäßigkeiten abfinden. Eigentlich blöd, warum fange ich an zu verhandeln, vor allem mit wem? Muss ich irgendetwas anbieten, damit ich etwas
anderes bekomme? Das erinnert mich an Svenja. Sie wünschte sich eine Wohnung mit Gartenzugang und war bereit, dafür sogar den Wunsch nach einer Badewanne aufzugeben. Und genauso kam es dann auch. Hinterher hat sie sich geärgert,
weil sie eigentlich beides verdient hätte: den Garten und die Badewanne. Und jetzt sitze ich hier und mache es genauso. Also, noch mal von vorn: Ich habe die große Liebe verdient, die vollendete Symbiose mit einem Mann, der von allem
etwas hat – ein richtiger Kerl, aber kein Macho, sensibel, aber kein Softie, jemand, der es genießt, mit mir zusammen zu sein, dem ich meine Gedanken und Geheimnisse ungeschützt bis in die letzte Ecke meines Herzens mitteilen
könnte, einer, der sich nicht für Schwächen oder Bedürfnisse schämt.
Ich kriege ein ganz schwermütiges Gefühl dabei. Ich bin so verflixt einsam. Die ganzen Jungs und Männer sind rückblickend mehr
oder weniger Katastrophen gewesen: Ich fliege immer auf den gleichen Typ, so eine Art Camel-Cowboy, cool und mit einer geballten Ladung Androgenen um sich. Wenn er dich ins Bett gekriegt hat, bist du verliebt und geschwächt. Ich frage, ob
wir uns am nächsten Tag sehen, und er antwortet: Ich ruf dich an. Und das tut er dann 48 Stunden lang nicht, in denen ich das Telefon anbete wie den heiligen Gral, mich nicht mal bis zum Briefkasten traue und auf der Toilette abzuziehen wage,
aus Angst ich könnte das Klingeln überhören. Und dann rufe ich ihn doch selbst an, und er ist gelangweilt, hat was zu tun, trifft sich lieber mit seinen Kumpels. Die pure Demütigung. Die anderen, bei denen es länger hielt,
die lebten irgendwie auf einem anderen Planeten. Ich konnte nicht zu ihnen durchdringen. Ich kam mir vor, als ob ich falsch ticke, zu hysterisch und zu klammernd bin, die falsche Sprache spreche. Uwe wollte nicht mal mit mir in den Urlaub fahren,
weil ihm das ein Zuviel an Nähe war. Für Benny war ich einfach nur Allround-Dienstleisterin. Ralf ging lieber mit einem Sachbuch ins Bett als mit einer Frau, er hasste das „Gekörpere“, wie er es nannte. Und ich dachte,
ich müsste ihn nur für zwei lieben, dann würde er sich schon an mich gewöhnen. Als ich dann Robin Norwood gelesen hatte, wusste ich, dass ich krank oder süchtig bin. Ralf und Robin Norwood habe ich gleichzeitig aufgegeben.
Bernd war ein Lückenbüßer, der arme Kerl. Er liebte mich, er verehrte mich und war zu allem bereit. Ich hatte die idiotische Idee, ein Kind kriegen zu müssen, um alle meine Probleme zu lösen. Bernd war begeistert. Ich
erinnere mich noch genau an die Nacht, als wir dieses Kind zeugten. Sechs Wochen später habe ich abgetrieben, beide, Bernd und seine ‚Tochter Anna’, wie er sie schon nannte. Danach trug er nur noch Trauer, färbte seine Haare
und sein Auto schwarz und schrieb Gedichte darüber, dass es ‚einen Tod vor dem Leben’ gibt. Ich kam mir wie ein Schwein vor. Er verdiente es nicht, das Kind auch nicht. Ein halbes Jahr lang habe ich diese Schuld mit mir herumgetragen.
Ich habe auch um dieses Kind getrauert. Ich habe sogar mit ihm gesprochen und es gebeten, mir zu verzeihen. In meinem Vorstellungen sah es aus wie eine kleine Elfe, die über meinen Schreibtisch schwebte und mit wispernder Stimme zu mir sprach.
Langsam glaube ich, dass ich an der Schwelle zur alten Jungfer stehe, nicht vermittelbar, mit völlig überzogenen Erwartungen. Jeder Liebesfilm im Kino gibt mir wieder Auftrieb und Hoffnung. Was so viele Menschen für möglich
halten, selber zu erleben scheinen und zum Film machen, muss es doch geben! Wenn ich eine solche Liebe erleben dürfte, könnte ich wahrscheinlich alles ertragen. Mist, ich fange schon wieder an zu verhandeln. Ich war nie wirklich allein.
Irgendwo war immer ein Kerl, der billig zu haben war, genau wie ich. Lieber einen Spatz im Bett, als die große Liebe auf dem Dach. Na ja, vielleicht ist das hier die große Chance, das Alleinsein zu lernen.“
Emma stand auf, um den leeren Teller in die Küche zu tragen. Ein Kamin ist wirklich pure Dialektik, dachte sie, vorne ist man gegrillt und am Rücken kalt wie ein Eisbär. Aber wer wendet sich schon wie eine Bratwurst vor einem Kamin?
Emma stieg die Treppe hinauf zum Schlafzimmer. In diesem Laura-Ashley-Traum sollte sie schlafen? Jedenfalls wäre es Schwachsinn, es nicht zu tun, denn das Gästezimmer sah nicht einladend genug aus. Paeonia hatte ihr dieses Schlafzimmer bewusst vorbereitet. Die Bettwäsche war frisch, die Knicke vom Bügeln zogen sich schnurgerade über die Decke. Emma knipste die Leselampe an. Sie sah aus dem Fenster, der Garten lag im Dunkeln. Sie konnte sich nicht entschließen, ins Bett zu gehen. Dazu brauchte man Vertrauen, und im Moment fühlte sie sich allein gelassen und ängstlich wie ein kleines Kind. Vielleicht würde es ihr etwas bringen, die Schlafzimmertür abzuschließen. Aber es steckte kein Schlüssel. Na gut, sie könnte auch einen Stuhl unter die Klinke klemmen. Blöderweise würde sie bis zum Einschlafen und beim Aufwachen diese augenfällige Demonstration ihrer Feigheit ansehen müssen.
„Super, Emma!“ schimpfte sie, „du bist auf dem besten Weg, eine Neurose zu erfinden. Am Schluss kannst du nur noch auf die blauen Kacheln im Bad treten, nur mit einem bestimmten Löffel essen und rückwärts durch Türen gehen. Fang nur an damit, du wirst schon merken, wohin es dich bringt.“
Sie ging zurück ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher ein. Aber an solchen Abenden ließ einen auch das Programm im Stich. Emma beschloss, sich eine Flasche Rotwein aufzumachen. Mit einem Glas Wein in der Hand stöberte sie durch Paeonias Bücherregale. Alle Bücher waren thematisch und alphabethisch nach Autoren geordnet. Es gab ein Regal mit den Klassikern: Hemingway, Joyce, Steinbeck, Tschechow, Goethe, Schiller, Hebbel, Tucholsky, Hesse, Frisch, Sartre. Es war ein Rundgang durch die europäische und amerikanische Literatur. Paeonia schien vorurteilslos zu sein, denn Salman Rushdie tauchte ebenfalls auf. Vier seiner Bücher standen da, rechts von der Bibel und links vom Koran eingerahmt. Es gab eine Reihe Philosophie, eine Reihe Psychologie, aber auch Science Fiction und Fantasy, der ganze Douglas Adams stand neben Werken von Asimov, Sagan, Hohlbein und Zimmer-Bradley, Gedichtbände von Mörike, Jandl, Rilke und Heine reihten sich aneinander. Weiter unten fand sich, nach den Krimis von Elisabeth George, Donna Leon und Martha Grimes, eine Sammlung von Gartenbüchern. Das interessanteste Regal untersuchte Emma zuletzt. Die Bücher schienen stärker zerlesen zu sein als alle anderen. Die Titel beschäftigten sich alle mit Spiritualität, Esoterik, Astrologie, Engeln, Elfen, Meistern, Aura, Meditation, Weltreligionen. Bei manchen konnte Emma sich nicht im Geringsten vorstellen, was das sein könnte. Auf einem Regalboden lag ein einziges, dickes, in Leder gebundenes Buch ohne Titel. Emma stellte ihr Glas ab, nahm den dicken Wälzer und schlug ihn auf: „Über das Suchen und Finden“ stand auf der ersten Seite. Das Inhaltsverzeichnis war leer. Ebenso die folgenden Seiten, zumindest, als Emma sie aufblätterte. In dem Moment als sie das Buch wieder schließen wollte, erschienen Buchstaben und die erste Seite füllte sich.
„Dies ist das Buch Deines Lebens. Nein, es beschreibt nicht dein Leben. Du brauchst nicht zu erschrecken. Vielmehr wird es das wichtigste Buch sein, das du jemals gelesen hast. Es schreibt sich, während du liest. Hab keine Sorge, es ist kein böser Zauber und keine schwarze Magie. Nimm es hin, dass es dieses Buch und in deiner Realität Dinge gibt, die du nicht erklären kannst, zumindest jetzt noch nicht. Manche Menschen finden dieses Buch. Indem du es jetzt in der Hand hast, beginnt deine Geschichte damit.“
Emma fühlte sich schwindlig und aufgeregt, voller Angst und Neugier. Sie zweifelte an ihrer Zurechnungsfähigkeit. Zugleich war ihr klar, dass sie dieses Buch lesen würde, denn etwas so Verrücktes verdiente es, gelesen zu werden. Hier passierte etwas Besonderes und Unerklärliches, und sie war allein damit.
Sie setzte sich mit dem Buch an den Kamin. Den Wein brachte sie in die Küche und holte sich statt dessen Mineralwasser. Sie musste sicher gehen, dass diese Sache nicht von einem halben Glas Rotwein kam.
„Jeder Mensch ist etwas Einzigartiges, auch du. Jeder kommt auf die Welt, um eine Aufgabe zu erledigen. Seine Seele hat sich etwas vorgenommen, hat diesen Körper, diese Eltern, diese Umstände gewählt, damit die Aufgabe sich entfalten kann. Darum urteile über keinen, der dir begegnet, halte ihn weder für faul, arrogant, fanatisch oder schlecht. Hindere ihn nicht an dem, was er tut, aber interessiere dich dafür, warum oder wozu er es tut. Wenn du merkst, dass jemand oder etwas dir nicht gut tut, dann geh deinen Weg weiter. Hass oder Mitleid sind unnötig, aber Mitgefühl ist unendlich wichtig. Du brauchst nicht das Leid anderer zu tragen, denn du trägst Verantwortung für Dich. Was auch immer deine Aufgabe ist, sie steht stets vor dir. Du erkennst sie vielleicht nicht, aber sie hat sich nicht getarnt oder versteckt. Es ist die übliche Geschichte mit den Bäumen und dem Wald. Erkenne dich selbst. Wie würdest du dich beschreiben? Was kannst du besonders gut, welche Tätigkeiten erfüllen dich und machen dich glücklich? Wovor fürchtest du dich am meisten? Wo sind deine Schwächen? Was berührt dein Herz? Was ist deine größte Sehnsucht?“
Emma sah in die Flammen. Dieses Buch stellte ihr jene Fragen, die sie in letzter Zeit selbst hatte, hier aber ganz bewusst. Eigentlich hätte sie sich nun fürchten müssen, aber von diesem Buch schien eine große Fürsorge auszugehen. Es schien sie in die Arme zu nehmen.
„Jeder Mensch ist auf der Suche. Es ist, als hätte er eine Schatzkarte mit auf den Weg bekommen. Und er fragt sich, was wohl der Schatz ist, und wann und wie er ihn findet, ja sogar, ob er ihn jemals findet. Aber dieser Schatz erfüllt ihn mit einer tiefen Sehnsucht. Der Schatz wird alle Fragen beantworten, alle Wünsche erfüllen und geben, was man am nötigsten braucht. Sieh dir die Menschen an. Sind es nicht alles Getriebene und Vertriebene? Sie suchen das Glück. Jeder hat sich eine Definition zurechtgebastelt, was Glück für ihn ist: viel Geld zu haben, einen Partner zu finden, Erfolg zu haben, Ruhm zu erwerben. Alle wollen etwas Besonderes sein. Sie stellen sich vor, dass ein Lichtstrahl auf sie gerichtet wird und sie vor allen anderen heraushebt. Jeder ist einzigartig, aber keiner ist etwas Besonderes, weil ihr alle gleich seid. Zusammen ergebt ihr eine Symphonie, aber ihr habt noch nicht gelernt, das Stück gemeinsam zu spielen. Und so fiedelt jeder an seiner kleinen kläglichen Melodie und wundert sich, warum es so armselig klingt, wo denn das Rauschen und Tosen bleibt, und wo die Komposition ist, zu der eure Melodie perfekt passt.“
Emma fühlte sich einsam. Es stimmte so sehr, dass sie sich nach irgendetwas sehnte. Manches konnte sie benennen, zum Beispiel Liebe, anderes schien vage zu bleiben. Und sie hatte das Gefühl, kämpfen zu müssen, als sei alles nur
durch harte Arbeit und gegen erbitterte Widerstände erreichbar. Das vermittelte ihr den Eindruck, als ob sie es nicht bekommen sollte oder verdiente. Außerdem fürchtete sie sich. Ihr Leben war von Sorgen und Ängsten geprägt.
Nicht, dass es Anlass dazu gegeben hätte. Aber ihr Grundgefühl war, dass es so viele Gefahren gab und so viel Schlimmes passieren konnte. Wenn sie ihr Denken losließ, dann passierte es meistens, dass sie sich die pessimistischste
Situation ausmalte. Eine Therapeutin hatte sie einmal gebeten, sich das Schlimmste auszudenken, das sie befürchtete. Emma war vor ihrem eigenen Schreckensgemälde zurückgewichen. Dann fragte die Therapeutin, was sie tun würde,
wenn sie nun in jener Situation wäre. Emma stellte fest, dass sie die Ärmel aufkrempeln würde, um das zu ändern, was sie beeinflussen könnte. Sie wunderte sich, wie schnell der schlimmste Fall seinen Schrecken verlor,
wenn man sich ihm stellte. „Das Allerschlimmste, was mir passieren kann, sind nicht bestimmte Umstände, sondern meine Ängste“, wurde ihr klar. Leider hatte die Einsicht nicht lange gehalten. Emma fürchtete sich weiterhin,
und oft vergaß sie sogar den „Trick“, nämlich sich zu überlegen, wie sie sich dann verhalten würde. „Beratungsresistent!“ konstatierte sie und schüttelte über sich selbst den Kopf.
Leseprobe II:
Fritz klappte das Buch zu, sah Emma an und schwieg.
„Sag was,“ drängte Emma, „sonst bekomme ich Angst.“
„Ich habe selber Angst. Also, lass uns mal vernünftig zusammenfassen: Du kommst hierher. Du hast Lisbeth nie vorher gesehen oder mit ihr gesprochen.
Du ziehst hier ein, findest das Buch am ersten Abend. Erst ist es leer, dann füllt es sich. Du liest jeden Tag darin. Nicht nur die Antworten stehen darin, sondern auch deine Fragen und Kommentare. Jetzt zeigst du mir das Buch, und jetzt
schreibt es mir auch...“
„Wahnsinn, nicht wahr? Ich bin nur froh, dass es dir auch schreibt. Das war wirklich eine einfache Beweisführung. Aber das ist noch nicht alles.“
„Nicht alles? Was kommt jetzt noch?
Raus damit, wo wir schon dabei sind.“
„Die Pflanzen sprechen mit mir. Im Garten. Da sitzen so kleine Figuren auf den Blüten. Sie nennen sich selber Devas.“ Emma beobachtete Fritz genau. Er hörte ihr offen und
aufmerksam zu, während er das Buch in seinen Händen hielt. „Ich habe sie entdeckt, als ich den Garten fotografiert habe. Sie waren zuerst auf den Fotos zu sehen, dann habe ich sie auch direkt auf den Pflanzen gesehen. Erst waren
sie irgendwie unscharf und neblig. Ich musste immer ein bisschen vorbeisehen und meine Augen unscharf stellen. Inzwischen sehe ich sie richtig. Sie sind etwas frech, aber sehr lustig. Und sie haben immer recht. Als wir zusammen ins Kino gegangen
sind, haben sie mir gesagt, was ich anziehen soll, sonst hätte ich womöglich im Kleid vor deinem Moped gestanden.“
„Ich fass’ es nicht.“
„Was hat das Buch dir gerade gesagt?“
„Es
hat mich an etwas erinnert. Ich habe es noch nie jemandem erzählt. Aber nachdem du dich nun getraut hast, mir so viel zu sagen, kann ich mich eigentlich auch nicht mehr blamieren. Ich habe als Kind Zwerge, Elfen und Feen und viele andere
Gestalten des Kleinen Volks gekannt und mit ihnen gespielt. Als ich in die Schule kam, merkte ich, dass die anderen Kinder keine solchen Freunde hatten. Meinen Eltern habe ich ein, zwei Mal davon erzählt, und dann hieß es: Das Kind
hat zuviel Phantasie, es kommt nach seinem Großvater. Und dann, so etwa mit zehn, elf Jahren, habe ich beschlossen, dass es Zeit wird, ein großer, vernünftiger Junge zu sein. Ich habe meine Freunde nicht mehr gerufen, saß
viel zu Hause herum und habe es irgendwann geschafft, die ganze Sache zu verdrängen. Ab dann kamen sie auch nicht mehr zu mir.“
„Na prima, von außen sehen wir aus wie zwei Bekloppte mit der gleichen Neurose, die sich
gefunden haben.“
„Immerhin. Ich hatte als Jugendlicher oft Angst, dass ich verrückt bin und in eine Anstalt müsste. Ich habe mich sehr davor gefürchtet, darum habe ich versucht, möglichst normal zu wirken,
nicht aufzufallen, nett und freundlich zu sein.“
„Heißt das, dass du dich eigentlich verstellst? Ich meine, wärst du eigentlich gern weniger nett, würde dir das mehr entsprechen? Bist du eigentlich ganz anders?“
„Das frage ich mich auch gelegentlich. Bevor ich reagiere, überlege ich meistens, was ich perspektivisch will. Wenn ich wütend werde, denke ich nach, ob es mir was bringt, den Zorn raus zu lassen, ob es den anderen verletzt,
was das für die Zukunft mit demjenigen heißt.“
„Du bist sehr kontrolliert.“
„Nein, das eigentlich nicht. Ich finde es völlig in Ordnung, erst nachzudenken und dann etwas zu sagen oder zu tun.
Haben deine Eltern das nicht auch immer von dir verlangt?“
„Nein, bei mir ging es eher darum, dass ich intelligent, aber faul bin oder zuviel lese, oder immer rede, wenn ich nicht gefragt wurde, dass ich Flausen und Unsinn im
Kopf hätte. Außerdem hieß es immer, ich wäre verwöhnt. Daraufhin hatte ich ständig den Eindruck, verzichten zu müssen. Und so kam ich dazu zu glauben, ich würde nie von etwas genug haben. Ich habe immer
Mangel empfunden.“
„Ist das nicht herrlich: Selbst die gutwilligsten Eltern schaffen es, einem die Kindheit zu verkorksen und ein Trauma herzustellen, an dem man ewig arbeiten muss, bis man es hinter sich hat und endlich der
Mensch ist, der man sein will.“
„Da hast du recht. Bist du denn bei mir so, wie du sein willst?“
„Wenn ich unsere kurze Beziehungszeit mal eben Revue passieren lasse: Ich glaube, ich war noch nie so sehr ich
wie mit dir. Aber ich bin sicher, dass das erst der Anfang ist.“
„Es freut mich jedes Mal, wenn du etwas Perspektivisches, etwas über eine gemeinsame Zukunft sagst. Den meisten Männern, mit denen ich zusammen war, musste
ich so was immer aus der Nase ziehen. Und was sie dann sagten, war selten überzeugend.“
„Dann waren es ein Haufen Esel. Du bist wunderbar. Ich muss mich eher bremsen, damit ich dich nicht vor Begeisterung über den Haufen
renne.“
„Bitte tu es. Ich bin süchtig danach, es füllt meinen leeren Speicher auf. Ach, und noch was, für Deinen Speicher: Mir geht es genauso.“
„Was machen wir jetzt damit? Nicht mit uns, meine ich, da fällt
mir genug ein, sondern mit dem Buch, den Devas und dem Kleinen Volk?“
„Die meisten Leute würden sich bei den Medien melden und die Sache für einen Menge Geld verbraten. Obwohl ich glaube, dass es nicht funktioniert,
es jemandem aus Sensationslust zu zeigen.“
„Mir ist auch gar nicht danach zumute. Vielleicht sollten wir einfach Zeit damit verbringen, Erfahrungen damit machen, es besser verstehen. Es steckt etwas dahinter, da bin ich sicher.“
„Ein Hinweis, eine Aufgabe?“
„Ein Geschenk, was weiß ich? Es gehört nun einfach zu uns beiden dazu.“
„Wie sollen wir drangehen? Machen wir etwas wie Feldforschung oder Experimente?“
„Ich weiß nicht, ob sich das machen lässt. Als Kind habe ich schon gemerkt, dass sie alles wussten, was ich dachte und vorhatte.
Da kann man sich nicht verstellen. Darum halte ich es für besser, es einfach geschehen zu lassen. Da werden wir genug erleben. Ich helfe dir im Garten. Vielleicht kommt das Kleine Volk wieder zu mir.“
Als Fritz seinen Satz beendet hatte, erschien eine Gestalt vor dem Kamin.
„Na, endlich,“ sagte sie, „ich habe schon gedacht, du würdest uns nie wieder einladen. Wir sind in dieser Beziehung sehr rücksichtsvoll.“
„Da bist du ja wieder,“ rief Fritz nach einer kurzen Überraschungspause. „Emma, darf ich vorstellen, der beste Freund meiner Kindheit, ein Zwerg. Darf ich Emma deinen Namen sagen?“
„Immer langsam, Fritz.
Vorher will ich etwas zur Einleitung und zur Bedeutung der Namen beim Kleinen Volk sagen. Erst einmal guten Tag, Emma.“ Er nahm seine grüne Mütze ab und verneigte sich fast bis auf den Boden. Emma nickte ihm etwas verunsichert
zu.
„Zuerst will ich sagen, dass wir ganz verschiedene Spezies haben,“ begann der Zwerg. „Jeder hat seine Aufgabe. Die Elementargeister, zu denen auch die Devas gehören, kümmern sich darum, dass die Natur funktioniert,
dass alles wächst und im Gleichgewicht ist. Du kannst dir vorstellen, dass wir damit ganz schöne Schwierigkeiten haben, seit es Umweltverschmutzung, Regenwaldabholzung und die vielen anderen naturfeindlichen Aktivitäten gibt, die
Menschen sich so leisten. Unsere Welten existieren parallel. Nein, besser gesagt: Es gibt viele Dimensionen. Ihr lebt hier in der dritten Dimension. Zwischen unserer Welt und eurer konnte man in früheren Zeiten leicht hin- und herpendeln.
Die Menschen und das Kleine Volk besuchten sich. Es gehörte einfach dazu, dass man sich sein Umfeld mit Zwergen, Elfen, Feen, Hausgeistern, Elementargeistern und vielem anderen teilte. Wir sprachen miteinander, wir gaben uns gegenseitig unsere
Schätze und unser Wissen. Kein Eingriff in die Natur, keine Saat, keine Ernte wurden getan, ohne dass wir uns darüber verständigten, was das Beste ist, wie es gut funktioniert. Inzwischen fragt uns kaum einer mehr. Das Ergebnis
könnt ihr sehen. Und unsere Welten entfernen sich voneinander. Wir treffen nur noch wenige Menschen, die sich an Erfahrungen aus früheren Leben mit uns erinnern, und gelegentlich solche, die uns suchen und einladen. Die Menschen leben
nur noch mit dem Kopf, mit ihrem Verstand, ihrem Ego. Sie haben aufgehört, sich als Ganzes zu fühlen, obwohl die Sehnsucht nach dem Ganzsein immer noch da ist, aber sie ist ungerichtet. Die Meisten denken, ihre Sehnsucht würde sich
erfüllen, wenn sie etwas besitzen. Aber sobald sie es haben, wollen sie wieder etwas Neues. Dabei wird bei euch, in Büchern und Vorträgen, in Filmen und Gesprächen darauf hingewiesen und erklärt, dass es anders geht. Wir
haben so viele von euch inspiriert, ihnen bewusst oder unbewusst die Worte und Gefühle für die Wahrheit eingegeben. Aber die Einsichten verpuffen, sie tauchen auf, werden gehört und verstanden, und verschwinden wieder. Ihr kümmert
euch nicht um das Eigentliche, sondern verbraucht euch im Uneigentlichen. Dennoch: Jeder Gedanke, jeder freundliche Umgang mit der Natur, und dazu zählt auch ihr beide, gibt uns einen Funken Hoffnung. Das Feuer der Wahrheit wird nie verlöschen,
auch wenn diese Welt zugrunde ginge, denn alles ist ewig. Es existiert im ewigen Jetzt. Aber in eurer Dimension kann es durchaus zu Ende gehen, wenn ihr die anderen Dimensionen nicht rechtzeitig wieder entdeckt. Ihr Beiden seid etwas Besonderes.
Ihr seid berufen worden. Vielleicht wundert ihr euch, dass es so lange dauerte, dass Fritz schon 20 Jahre lang die anderen Dimensionen zum Schweigen verurteilt hatte, dass du, Emma, erst jetzt davon erfährst. Zeit ist nicht das Thema für
das Kleine Volk, für uns sind auch 100 Jahre wie ein Tag. Es steht schon immer im universalen Gedächtnis all dessen, was ist, was war und was sein wird, dass ihr euch treffen würdet, denn ihr kennt euch schon lange. Viele Leben
habt ihr euch immer wieder gesucht, gefunden und habt euch weiter entwickelt... Und jetzt zu meinem wahren Namen. Wenn ich ihn dir sage, gebe ich dir Macht über mich, denn unsere Namen sind mehr als ein Schlüssel, mehr als Bedeutung.
Ich lasse zu, dass du in meine Aura, in mein Sein eindringst. Und da alles miteinander verbunden ist, wirst du in Alles aufgenommen. Ich hoffe, du bist dafür bereit. Zuerst musst du mich nun nach meinem Namen fragen und danach, ob ich ihn
dir sagen will. Das gehört zum Ritual dazu.“
Emma hielt Fritz’ Hand krampfhaft fest.
„Ich weiß nicht, wie sich Bereitsein anfühlt. Ich weiß gerade nur, dass sich alles richtig anfühlt. Natürlich bin ich auch sehr neugierig. Ich hoffe, dass das nicht
zum Punktabzug führt. Und etwas Angst habe ich auch. Gut. Ich frage dich, ob du mir deinen Namen sagen willst.“
„Danke für deine Frage, Emma. Sie ist gut gestellt und ich spüre, dass du reinen Herzens bist. Es
ist nicht schlimm, dass du verwirrt bist. Ich bin auch ein bisschen aus der Übung. Ja, ich werde dir meinen Namen sagen.“
Er beugte sich vor und flüsterte ihn Emma ins Ohr.
Im gleichen Moment fühlte Emma, wie sie
sich ausdehnte, über ihren Körper und dieses Zimmer hinaus, weit über die Landschaft, bis sie schließlich das ganze Universum umspannte. Sie spürte, dass sie noch sie selbst war, aber zugleich war sie Teil von Allem,
was existierte. Es war Erfüllung und Glück. Emma verstand Zusammenhänge. Sie spürte keine Angst mehr. Ihre bisherigen Sorgen waren verschwunden, aufgelöst in Liebe und Einsicht. Sie spürte die Aura des Zwerges, sie
fühlte alle Dimensionen gleichzeitig, sie war jedes Ding, das es gab. Zeit existierte nicht mehr, nur noch Sein. Und Fritz, dessen Hand sie die ganze Zeit hielt, war Teil von ihr und Allem.

Kurzbeschreibung zu „Eine intergalaktische Freundschaft“:
Ausnahmsweise und nur seiner Mutter zuliebe geht Paul eines Sonntags mit ihr in die Kirche. Plötzlich geschieht etwas Unglaubliches - Jesus zwinkert ihm vom Kreuz aus zu.
Kaum hat er sich von dem Schrecken erholt, nimmt Bagor, ein Außerirdischer von den Plejaden, mit ihm Kontakt auf - und eine intergalaktische Freundschaft nimmt ihren Anfang.
Doch bevor Paul die ersten Schritte mit seinem neuen Wissen von den Alcyoniern machen kann, wird er von anderen Außerirdischen entführt ...
Ein Roman, der Science-Fiction und Spiritualität, Love-Story und Komödie miteinander verbindet.
Leseprobe:
Wie es angefangen hat? Meine Güte, ganz unspektakulär. Meine Mutter hatte mich mit ihrer üblichen Jammer-Tour am Telefon bequatscht, dass sie arm, krank und einsam wäre, oder bald sterben würde, und ich schon merken
würde, wie sie mir dann fehlt... Nur damit ich sie endlich wieder einmal besuche. Die volle Packung: Gulasch mit Nudeln, Schmutzwäsche mitbringen, die Fotoalben der letzten fünf Jahre ansehen und end-lose Geschichten über Leute
anhören, die ich nicht oder längst nicht mehr kenne. Dazu noch die Standard-Beschwerde, dass ich endlich heiraten und ihr viele Enkel bescheren sollte. Also genau das, was sich Söhne unter einem entspannten Wochenende vorstellen.
Die Krönung war, und das wusste ich vorher schon, am Sonntagmorgen früh aufzustehen und mit Mutter in die Kirche zu gehen. Als hätte ich nicht schon in meiner Kindheit sämtliche Gottesdienste absolviert, die ein Durchschnittsmensch
hinter sich zu bringen hatte. Was habe ich auf harten Bänken gesessen, die seidenen Lesezeichen des Gesangbuchs aufgedröselt, sämtliche Biographien aller Texter und Komponisten gelesen und den olivgrün angeschimmelten, überlebens-großen
Jesus am Kreuz im Altarraum betrachtet.
In meiner Jugend brauchte ich keine Horrorstreifen, eine Stunde stures Geradeaus-Sehen im Gottesdienst reichte völlig. Ein süßlich grinsender Pfarrer und ein stets eben verstorbener Jesus haben mir ein geradezu körperliches Grundunwohlsein im Zusammenhang mit Kirche beschert. Dort hing er, mit den größten Nägeln aller Zeiten fest gepinnt wie ein ekelhafter Kühlschrankmagnet zur Erinnerung und blutete aus allen historisch belegten Löchern. Wobei mir die Verletzungen durch die Dornenkrone, deren Stacheln nicht unter zehn Zentimeter lang waren, noch am erträglichsten schienen. Und er machte mir klar, dass mein gebrochener kleiner Finger lachhaft war. Schmerz-Jesu-Therapie, mit freundlicher Unterstützung meiner Eltern-Firma. So lange noch ein Kind in Biafra hungerte, hatte ich weiße Bohnen zu essen, oder ich könnte sie höchstpersönlich dort runter tragen. Afrika war ‚unten’, und ich stellte mir vor, dass es auf dem Weg dorthin nur bergab ging. Wenn ich nicht aufpasste, würde mich der Schwung am Äquator ins Weltall hinaustragen, mit dem Teller Bohnen in der Hand.
Ich war also verpflichtet, meiner Mutter diese Stunde Selbstaufopferung zu spendieren, um mich wenigstens für ein Jahr wieder davon fernhalten zu können. Sie wollte ihrer Gemeinde, für deren Basare sie grauenhafte Handarbeiten anfertigte, zeigen, dass sie noch die Kontrolle über mich hatte, und ihre Erziehung fruchtbar gewesen war. Für den Höhepunkt hatte ich fälschlicherweise schon gehalten, dass sie mich in eins von Vaters Jacketts steckte, die sie immer noch aufhob, weil sie zu gut für die Altkleidersammlung waren. Wenn meine Bohnen gut genug für Afrika gewesen sind, warum nicht auch die mottenkugelstinkenden Klamotten meines toten Vaters? Das ist der wahre, alltägliche Rassismus. Als vor Jahren - ich steckte gerade im Abitur - eine afrikanische Gemeindedelegation unseren Sprengel besuchte, war Mutter völlig aus dem Häuschen. Sie bestellte ihren eigenen Afrikaner als persönlichen Pensionsgast und betüttelte ihn wie einen Fünfjährigen. Sie erklärte ihm die komplette moderne Welt. Ein besonderes Spektakel war, dass sie ihm die Funktion des Kühlschranks vorführte und ihn die Kälte eines halben Pfundes gekühlter Butter betasten ließ. Ich konnte mich diesem grauenhaften Schauspiel nicht entziehen, weil ich Mutters Simultan-Dolmetscher war. So versuchte ich, wenigstens in der Übersetzung diesem Wahnsinn die Spitzen zu nehmen. Bhoto, so hieß er, lächelte charmant-geduldig, und verwies freundlich auf die Fähigkeit seines Mutterlandes, ebenfalls und schon seit langem, Kühlschränke herzustellen. Als Mutter sich einmal für fünf Minuten ihrer Rundum-Versorgung entziehen musste, weil sie zur Toilette ging, sagte mir Bhoto in geradezu exkolonialer Demut: „Ich bin wie alle Menschen mit Eltern gesegnet und es erfüllte mich mit Freude, als ich endlich erwachsen war, um meine eigenen Wege zu gehen. Es wäre mir ein großes Anliegen, wenn Sie Ihrer Mutter mit dem gebotenen Respekt mitteilen könnten, dass ich nicht hierher gereist bin, um wieder unter elterliche Obhut zu kommen.“ Als ich das für Mutter, ebenfalls mit Kappung der Spitzenwerte, übersetzte, war sie eingeschnappt. Ich verzichtete auf die Übersetzung ihrer Kommentare. Die konnte Bhoto leicht erraten. Mutter verlieh ihn sehr schnell an eine der Damen aus der Frauenhilfe. Ihre Haltung zu Afrika hat sich seither grundlegend verändert. Im Moment zieht sie einheimische Obdachlose vor, zumindest so lange, bis sie einen kennen lernt.
Insofern war meine seelische Grundverfassung schon am Tiefpunkt, als ich mit zweimal umgeklappten Ärmeln und Mutter in Richtung Kirche zog. Sie zerrte mich in die dritte Reihe, direkt hinter die pubertär unruhigen Konfirmanden, erstens, weil dann jeder uns sehen konnte und zweitens, weil Gott, in seiner Jahrtausende alten Schwerhörigkeit, dort Mutters Gebete besser verstehen könnte. Gott ist in der Kirche immer mehr vorne als hinten. Den Organisten hinten oben dürfte er also nie erreicht haben. Das ist bestimmt der Grund für den Niedergang der modernen Kirchenmusik oder die Quälereien, denen wir durch Kirchenmusiker ausgesetzt sind. Der Pfarrer meiner Jugend war längst im Ruhestand, aber er hatte dafür gesorgt, dass ein jüngerer Klon seiner selbst diesen Posten übernommen hatte.
Und dann passierte es. Mitten in der Predigt: Der verwesende Jesus am Kreuz zwinkerte mir zu! Ich schob es auf Übermüdung und die Verdauungsprobleme bei gutbürgerlichem Essen, betrachtete fünf Minuten lang den digitalen Sekundenüberfluss meiner Armbanduhr und hob dann wieder den Blick zum freudigen Sterbenssymbol der Christenheit. Er tat es schon wieder! „Mutter, fällt dir an dem Jesus dort was auf?“ flüsterte ich. „Scht,“ war die Antwort und sie klebte weiterhin ihren Blick auf den Pfarrer, der gerade am Ufer der Aufzählungsverliebtheit gestrandet war: „...Großes und Kleines, Schwaches und Starkes, Gerettetes und Verlorenes...“. Jesus zwinkerte weiter und gestattete sich sogar ein verwegenes Grinsen. Ich war fertig. Entweder war das ein Wunder, und ich hatte die Gelegenheit, aus dieser Kirche einen Wallfahrtsort zu machen, mich selbst in eine Anstalt einzuweisen oder aufgrund eines mystischen Erlebnisses, erleuchteter Eremit oder Guru zu werden.
Nach dem Gottesdienst verzogen sich die Besucher ins Gemeindehaus zum üblichen Kaffee. Ich gab vor, noch einen Moment in der Kirche allein sein zu wollen, was meiner Mutter ein Leuchten ins Gesicht zauberte. Ich stellte mich auf die Stufen vor
den Altarraum, hob meinen Blick zum mittlerweile wieder statischen Kruzifix und sagte halblaut: „Was soll das?“
Prompt erklang die Antwort vom Kreuz: „Eine echt überzeugende Art, deine Aufmerksamkeit zu erregen, was?“
Ich erstarrte und fragte fast ängstlich: „Jesus?“
„Der hat was, nicht wahr? Und diese Supershow spielt seit Ewigkeiten Tantiemen ein. Im Ernst, der hat euch was voraus.“
„Er hatte.“ Ich hatte
mich wieder etwas gefasst und sagte:
„ Lenk nicht vom Thema ab. Wo und wer bist du?“
„Noch ein kleiner Exkurs, bitte: Er hat, und zwar immer noch. Aber davon vielleicht später. Ich bin hier. Im Moment bediene
ich mich dieser Atomansammlung, die du als frommes Kunstwerk wahrnimmst.“
„Ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, dass das hier jeder Naturwissenschaft, physikalischer Wahrscheinlichkeit und menschlicher Erfahrung spottet:
Warum benutzt du nicht deine eigenen Atome?“
„Mach ich doch. Ich metamorphe nur ein bisschen. So was können bei uns schon die Kinder oder das, was ihr Kinder nennen würdet.“
„Bei euch? Was soll das
heißen?“
„Ich bin Plejadier. Na ja, wobei das Thema Ich’ schon wieder einen Exkurs wert wäre ...“
„Nix da mit Exkursen. Wir bleiben jetzt erst einmal bei diesem Plejadenzeug.“
„Nix da mit Plejadenzeug,
um es mit deinen Worten zu sagen. Hast du denn nicht die geringste Ahnung von Astronomie? Ich komme von den Plejaden, eine offene Sterngruppe im Sternbild des Stiers, die immer wieder Entzückensschreie auslöst, weil sie so niedlich beieinander
zu stehen scheinen. Etwa 400 Lichtjahre von euch entfernt. Ihr betrachtet also gerade unseren Status von etwa 1630 Anno Domini. Aber das macht nichts. Wir waren damals schon klasse. Ach, damals, Zeit, das wäre auch ein hübscher Exkurs...“
Ich holte schon wieder Luft, um ihn oder dieses Etwas einzufangen, das meinen Kindheits-Jesus mit Special Effekts bewegen konnte.
„Ok, ok, ich bleib dran. Ich komme von Alcyone. Eure Esoteriker liegen nicht ganz falsch, wenn sie
uns große Bedeutung beimessen.“
„Oh, Mann, jetzt auch noch Esoterik. Wir stehen hier in einer stinknormalen evangelischen Kirche. Die sind in dieser Beziehung völlig clean: Bibel, Gott, Jesus, Heiliger Geist und fertig.
Und ich bin übrigens genauso durchschnittlich, in den Dreißigern, einen netten Job, eine Wohnung...“
„Was ist mit Frauen?“
„Wie, was ist mit Frauen?“
„Wo ist dein Gegenstück?
Ihr tretet doch immer paarweise auf. So steht es in meiner Enzyklopädie.“
„Dann steht da vielleicht auch drin, dass davor eine Suchphase kommt, in der man nach dem passenden Gegenstück die Landschaft durchkämmt.
Sag mal, was soll der Mist? Ich unterhalte mich hier nicht mit einem Kruzifix.“
„Sieht aber ganz so aus. Können wir gehen? Deine Mutter kommt gleich.“
„Wir? Wohin willst du denn gehen? Steigst du jetzt
vom Kreuz herunter?“
„Das gab’s schon mal, Ich halte nichts von Dubletten. Also, bis gleich.“
Kurzbeschreibung zu „Der erfüllte Wunsch“:
Anne und Peter sind glücklich verheiratet, die Kinder sind aus dem Haus. Das Gefühl der inneren Leere und viele offene Fragen verursachen bei Anne die Sehnsucht nach etwas Großartigem, nach einer Veränderung.
Ein Urlaub auf Korsika und die Begegnung mit Reiki erfüllen diesen Wunsch. Aber auch wahr gewordene Träume haben eine Schattenseite.
Wie soll sie mit ihrer neu entdeckten Gabe umgehen? Warum halten so viele sie für einen Guru? Mit Hilfe ihres pragmatischen und liebevollen Ehemanns kämpft Anne sich durch einen Prozess der Selbstfindung.
Leseprobe:
EINS
Anne wachte schweißnass aus einem Albtraum auf. Während das Adrenalin in ihrem Körper verebbte, blickte sie sich im Schlafzimmer um und war dankbar, dass dies ihre Realität war. Die Straßenlaternen warfen genug Licht, um sich in der Dunkelheit zurecht zu finden.
„Scheißträume,“ fluchte sie. „Immerhin ist mein Leben besser als meine Träume. Umgekehrt würde ich es nicht haben wollen.“ Die Träume kamen nicht oft, dafür regelmäßig. Sie versuchte sich zu erinnern: Sie war über die Oberfläche eines unwirtlichen Planeten geflogen. Die Gegend war grau und bizarr gewesen. Es hatte keine Ebenen gegeben, sondern nur Abertausende messerspitzer Felsen, die wie scharfe Klingen hochragten. Und eine Stimme aus dem Off hatte ihr mitgeteilt, dass dies die ‚Landschaft der Verzweiflung’ sei. Genau dieses Gefühl hatte sie beim Überflug gehabt: So musste sich jemand fühlen, dem der Tod vor Augen stand, der keine Hoffnung hatte und an nichts glaubte. Aber warum sollte sie dieses Land sehen, wenn es nicht ihr eigenes war, oder war es das doch? Natürlich hatte es Tiefpunkte in ihrem Leben gegeben, aber selbst die schlimmste Situation hatte entspannte Momente gehabt, in denen es ihr zeitweise gut ging und sie ihr Elend vergessen konnte. Außerdem hatte sie geglaubt, keine Angst vor dem Tod zu haben. Trotzdem hatte sie sich im Traum davor gefürchtet.
„Wenn es einen Himmel gibt, dann hoffe ich, mir die Eintrittskarte irgendwie verdient zu haben,“ sinnierte sie. „Wenn zusätzlich eine Hölle vorhanden ist, kann ich nichts dafür, dass ich nicht katholisch getauft wurde. Meine Sünden halte ich für zu durchschnittlich, als dass sie Höllenqualitäten hätten. Ich hoffe bloß, dass der Himmel nicht so ist, wie ich ihn mir ausmale, sondern besser. Wenn nach dem Tod aber das Nichts kommt, werde ich es nicht mehr merken. Ich zerfalle in meine Atome und werde Dünger. Aber noch ist es nicht so weit. Ich bin jung genug, um noch ein paar Jahrzehnte vor mir zu haben. Ich beschäftige mich schon seit meiner Kindheit mit der Frage nach dem Tod und dem Sinn des Lebens. Warum hatte ich bloß solche Angst in diesem Traum? Wenn das der Zustand meines Unterbewusstseins ist, prost Mahlzeit, dann ist mir nicht zu helfen.“
Sie drehte sich zur Seite und streichelte ihrem Mann über die Schulter, die unter der Bettdecke hervorsah. Er bewegte sich und murmelte: „Was ist?“
„Ach, Schatz, ich habe grauenhaft geträumt.“
„Komm
her.“ Er hob schläfrig die Decke an und drehte sich auf den Rücken. Sie legte ihren Kopf in seine Armbeuge, genoss die Wärme seines Körpers und schlief wieder ein.
Am nächsten Morgen hing der Traum nur noch wie eine leise Hintergrundmelodie in Annes Gedanken. Sie war froh, dass sich die Nachtangst im Tageslicht auflöste. Es wirkte geradezu lächerlich auf sie, wie sehr sie sich in der Nacht gefürchtet hatte. Übrig blieb die Einsicht, die sie schon vorher gekannt hatte: Egal wie gut ein Mensch innerhalb von Beziehungen aufgehoben ist, im Sterben war er allein. Vielleicht war das Grund genug, sich fürchten zu müssen. Der Gläubige kann sich am jeweiligen Gott festhalten, der Ungläubige an seinen Erinnerungen, seiner Würde oder was auch immer ihm Halt gibt. Darüber lässt sich prächtig distanziert philosophieren, wenn die Sonne durch das Küchenfenster scheint, der Kaffee dampft und die Tageszeitung auf dem Tisch wartet.
Anne überflog die erste Seite: einmal nachsehen, was der Welt heute wichtig erschien. Sie hatten zwei Tageszeitungen abonniert, um die Nachrichten und Meinungen vergleichen zu können. Außerdem gab es am Frühstückstisch dann weniger Gerangel. Aber das war nur theoretisch so, denn eigentlich lasen sie und ihr Mann Peter die eine der beiden Zeitungen lieber. Das andere Abonnement kündigten sie dennoch nicht. Immerhin hatte Peter zwei Sportteile. Die Lokalausgaben waren Annes private Stücke Papier. Sie wollte immer wissen, was in der Stadt gerade los war und endete stets bei den Familienanzeigen. Danach waren nur noch die Beilagen dran, die aber für sie nicht als Zeitung galten, eher als ein Panoptikum der Wunscherzeugung. „Geiz ist nur geil, wenn man etwas nicht kaufen will!“ schimpfte sie. Peter liebte die Beilagen. Wenn er keine Zeit zum Lesen hatte, dann nahm er nur die Beilagen mit auf die Toilette.
Eine Todesanzeige sagt viel über die Beziehung der Lebenden zu den Toten. Die Meisten bedienten sich im Stress dieser Ausnahmesituation nur bei den Textstücken, die eine mehr oder weniger mitfühlende Anzeigenverkäuferin anbietet. Es gab regelrechte Mode-Erscheinungen: Texte aus „Der kleine Prinz“ oder ein Rilkegedicht waren derzeit dran. Manchmal war der Anzeige ein Foto hinterlegt, die übliche Herbstallee oder ein einzelner blätterloser Baum, immer trostlos, selten schön. War das die Sicht der Überlebenden auf den Tod oder eher der Ausdruck des frischen Schocks der Leere und Einsamkeit? Manchen Anzeigen merkte man die Sprachlosigkeit des Schreckens an. Aus jedem Wort sprach verzweifelte Verwirrung und das ewig antwortlose Warum. Anderen merkte man die Erleichterung an, dass ein Leben nach Qualen zu Ende gegangen war, oder die gefühllose Wahrnehmung einer Ansagepflicht.
Als Anne in ihrer Jugend angefangen hatte, regelmäßig Zeitung zu lesen, hatten die Geburtsdaten der Verstorbenen noch teilweise im 19. Jahrhundert gelegen. Jetzt war die Kriegsgeneration dran. Schon entdeckte sie manchmal ihren eigenen Jahrgang. Dass Menschen mit 45 sterben, war aber längst nicht so tragisch wie der Tod in den Zwanzigern. Man nahm an, dass derjenige immerhin etwas vom Leben gehabt hatte. Schade, aber akzeptabel. Anne hatte sogar schon über ihre eigene Todesanzeige nachgedacht. Peter fand das makaber. Er lehnte es ab, sich mit dem Tod zu beschäftigen und damit Löcher in die warme Decke seines Lebens zu machen, durch die seine Angst hereinscheinen konnte. Anne wünschte sich eine bunte Anzeige und das bewegende Finale eines Gedichts von Reiner Kunze: „... und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein.“
Geburts- und Hochzeitsanzeigen waren für Anne ähnlich gestrickt wie Todesanzeigen, nur eben mit dem Grundakkord von Dankbarkeit, Optimismus und Hoffnung.
Vom Wohnzimmer drang leise der Gesang von Nat King Cole herüber. Anne hörte morgens nur Musik von CDs. Sie ertrug es nicht, dass man sie aus dem Radio allzu lebhaft mit Werbung und schlechten Nachrichten überschüttete. Außerdem war sie noch nicht bereit, jemandem zuzuhören. Peter ließ sie in Ruhe, damit sie langsam von der Welle der morgendlichen Routine in den Tag getragen wurde. Er lächelte sie liebevoll über den Rand der Zeitung an, checkte danach seine Emails am Notebook, das auf dem Esstisch stand und las ihr höchstens einen witzigen Sportkommentar vor, bis sie zu einer Unterhaltung bereit war.
Nachdem die Kinder aus dem Haus waren, empfand Anne ihr Familienleben als geradezu beschaulich. Ihre Tochter studierte, und ihr Sohn machte eine Lehre. Beide hatten sich so sehr von zu Hause abgenabelt, dass sie selten anriefen. Wenn sie mal vorbeikamen, war es für Anne, als würde ein Schwarm Wespen über sie herfallen: Das Haus dröhnte, die Waschmaschine lief ständig, das Telefon klingelte in einem fort, der Bass von mindestens zwei Musikanlagen versetzte die Stockwerke in Schwingungen, halbleere Müslischälchen gammelten vor sich hin, auf dem Herd köchelte ein Essen und Anne räumte ständig auf, damit sie das Gefühl behielt, ihr Leben sei in Ordnung. Sie fragte sich, wie sie sich so schnell das Leben mit den Kindern abgewöhnen konnte, und warum es ihr jetzt schon wie eine Belastung vorkam. Außerdem war es ihr nachträglich ein Rätsel, wie sie ihren Job und den Haushalt hinbekommen hatte. Natürlich war es schön, die Kinder bei sich zu haben, an ihrem Leben ein Häppchen teilnehmen zu dürfen und sie zu verwöhnen. Aber auch nicht zu lang. Wenn sich die beiden verabschiedet hatten, empfand sie eine Mischung aus Bedauern und Erleichterung. Beim Winken schickte sie ihnen einen Segen hinterher. Sie würden schon zurechtkommen. Danach fielen Peter und Anne sich in die Arme. Peter flüsterte ihr „Wieder nur wir beide, das finde ich am schönsten“ durch die dunklen Locken ins Ohr.
Bei ihren Freunden war das die Phase, in der einige sich trennten, weil es außer den Kindern nichts Verbindendes gegeben hatte. Anne und Peter dagegen genossen es wie zwei frisch Verliebte, wieder zum Ausgangspunkt der Zweisamkeit zurück zu kehren, und den Faden ihrer Symbiose weiter zu spinnen.
Von außen wirkten die Beiden wie das perfekte Paar. Es gab nicht diese gemeinen Sticheleien vor anderen, die Bloßstellung des Partners, um sich besser zu fühlen, oder das stillschweigende Nebeneinanderherleben mangels Alternativen.
„Was meinst du, warum wir so ein tolles Paar sind, Schatz?“ fragte Anne zwischen zwei Geburtsanzeigen für Kinder, die ihr Leben mit den Namen Nele und Leon zubringen mussten.
„Wir haben das Geheimnis der Harmonie gefunden.
Wie kommst du darauf?“ antwortete Peter mit einem Bissen Marmeladenbrot im Mund.
„Andere trennen sich, und wir finden uns noch mehr.“
„Ich glaube, es liegt daran, dass wir einander nie ändern wollten, abgesehen
davon, dass wir anfangs ein paar Ecken und Kanten abgeschliffen haben. Die meisten Frauen suchen sich doch einen Kerl heraus, den sie toll finden, und kaum haben sie ihn fest an der Angel, beginnt der Umerziehungsprozess zu einem Hündchen,
das ‚sitz’ macht und apportiert.“
„Aber du bist doch ein braves Hündchen!“
„Ich bin es freiwillig, aus purer Lust. Außerdem habe ich von dir gelernt, dass man über alles sprechen
kann. Die meisten Liebesfilme dauern doch nur deswegen so lang, weil Einer oder Beide nicht sagen, was sie wirklich fühlen.“
„Und wir lassen uns gegenseitig das Recht auf die subjektive Wahrnehmung,“ ergänzte Anne.
„Eine unserer größten Errungenschaften, mein Schatz. Man darf wütend oder traurig sein, obwohl es vielleicht
gar keinen objektiven Anlass dafür gibt. Es dreht sich bei uns nicht ums Rechthaben. Bei den meisten Paaren geht es immer darum, wer im Recht ist und wer nicht. Man kommt einfach leichter aus der Ecke eines schlechten Gefühls, wenn einem
niemand abspricht, sich dort aufhalten zu dürfen.“
„Außerdem finde ich dich einfach toll!“
„Anne, meine Süße, du bist blind und taub. Ich bin ein Mann, der bald 50 wird. Ich habe einen
Bauch, zu wenig Haare, sehe nicht aus wie Keanu Reeves, mein Hintern fängt an zu hängen, und ich schnarche.“
„Ich kenne diesen Kerl nicht, den du beschreibst. Ich sehe einen attraktiven Typ, bei dem ich noch immer Herzklopfen
kriege, wenn er mich anlächelt.“
„Der liebe Gott möge deine Wahrnehmungsstörung lange erhalten!“
„Amen! Ich muss jetzt los. Denk dran, den Mülleimer noch vor die Tür zu stellen.“
„Wau, Herrin, wau, natürlich!“
Anne mochte ihren Job, und zugleich ging er ihr allmählich auf die Nerven. Wenn man über zehn Jahre das Gleiche getan hat, gibt es keine Überraschungen mehr, die Tiefen sind ausgelotet. Das Neue ist nur eine Konjugation des Alten. Trotzdem hatte sie nicht den Mut, sich nach etwas Anderem umzusehen, weil ihr die Routine Sicherheit gab. Eine neue Arbeit hätte den inneren Aufruhr eines Aufbruchs bedeutet, neue Kollegen, veränderte Strukturen, ein neuer Chef. Zu viele unbekannte Faktoren, die sie zwar objektiv hätte bewältigen können, wozu sie aber keine Lust hatte. Sie kannte genug Menschen, die sich täglich zu einer Arbeit schleppten und sie hassten. Anne hingegen tauchte jeden Tag ein, vergaß sich fast völlig in den Anforderungen des Jobs, wunderte sich, wie schnell die Zeit verging und wurde am Ende des Tages aus dem Büro gespült mit der erstaunlichen Erkenntnis, dass sie vor der Tür von ihrem eigenen Leben in Empfang genommen wurde und wieder Anne war. In Bezug auf die Arbeit war dieses selbstvergessene Funktionieren sicher ein Segen, aber inzwischen fragte sie sich, ob sie sich nicht selbst verpasste, während die Jahre dahinzogen. War das ein erfülltes Leben? Gab es zwei Annes oder nur eine? Welche war die Echte? Worin bestand der Sinn, wenn man auf Abende, Wochenenden und den Urlaub hin lebte? Gab es eine Aufgabe, die ihr Leben zu etwas Besonderem machte? War es nötig, sie zu erkennen, oder würde sie erst auf dem Totenbett realisieren, dass sie genau das Richtige oder das Falsche getan hatte?
Der Fußweg zum Büro reichte aus für Gedanken wie diese, einen Blick in den Himmel und einen kurzen Überblick darüber, wie der Tag werden könnte. Wenn sie nicht zu spät dran war, begegnete ihr der alte Mann mit dem kleinen Hund und grüßte sie wie immer sehr freundlich. „Auch eine Art Lebensgemeinschaft,“ dachte Anne. „Wer weiß, was es ihm bedeutet? Vielleicht bin ich für ihn der einzige Kontakt zur Welt, so wie einsame alte Damen täglich mit der Kassiererin bei Edeka sprechen, weil sie sonst niemanden haben. Immerhin hat er seinen Hund. Jeder sollte im Alter ein Tier haben, damit er das Gefühl hat, gebraucht zu werden. Reicht ein Goldfisch dafür aus? Oder ist ein Tier letztlich nur fleischgewordenes Armutszeugnis einer modernen Zeit, die Kommunikation nur mit effektiven, funktionierenden Lebewesen pflegt? Vielleicht gibt es ja einen Chatroom ‚Wir über 70’, wo man seine Einsamkeit im Austausch mit einer 83jährigen Neuseeländerin und einem 77jährigen US-Veteranen ausblenden kann.“
Im Büro röchelte schon die Kaffeemaschine, die ihre Kollegin angeworfen hatte. Der Tag entwickelte seinen Strudel und sog Anne hinein. Sie stellte ihren Rechner an und die Kaffeetasse auf den Untersetzer, legte sich den Tagesplan zurecht und nahm den ersten Anruf an.
Am Abend trugen Anne und Peter ihre Teller mit Spaghetti ins Wohnzimmer und machten es sich vor dem Fernseher gemütlich. „Gib mir mal ein Esskissen rüber!“ Anne streckte die Hand aus. Die gemusterten Sofakissen eigneten sich
prima als Tischersatz auf den Knien zum Essen. Ein Soßenfleck fiel darauf nicht auf.
„Sind wir Banausen, weil wir das Essen nicht am Tisch zelebrieren?“ fragte Anne.
„Sind wir nicht!“ beschied Peter.
„Wir machen nur etwas, das uns beiden Spaß macht. Ich bin sicher, die meisten Leute würden lebenslang ihr Essen auf den Knien einnehmen wollen, wenn sie dafür eine glückliche Beziehung bekämen.“
„Das
ist schon eine komische Art Frömmigkeit, wenn man immer einen Tauschhandel anbieten muss: fünf Vaterunser gegen einmal den Bus nicht verpassen, der Nachbarin die Tasche hoch tragen gegen einen minder schweren Familiensturm wegen einer
verkorksten Mathearbeit, Essen auf den Knien gegen Beziehung. Das muss ein seltsamer Gott sein, dem so etwas gefällt, eine echte Krämerseele. So einer lässt nicht anschreiben. Ha, jetzt weiß ich, warum manchmal einzelne Schuhe
auf der Autobahn liegen: Da hat einer Gott seinen rechten Schuh geschenkt, damit er aus dem Stau herauskommt.“
Peter lachte und blickte auf den Fernseher, wo die üblichen Horrormeldungen abliefen, Tornados mit malerischen Namen
und grauenhaften Auswirkungen, Arbeitslosigkeit, Börsenflau, der Tod einer Dichterin, gemischtes Wetter.
„Ich hätte Lust, mal ein Jahr im Ausland zu verbringen.“ Anne war schon bedient von den Nachrichten und nutzte die Zeit lieber für eine Unterhaltung mit Peter.
„Wirklich? Wir sind doch nicht mal in der Lage, länger
als 14 Tage Urlaub zu machen, ohne Heimweh zu bekommen.“
„Ich stelle mir das eher wie ein Abenteuer vor. Wir hätten eine Aufgabe, die uns so beschäftigt, dass wir abgelenkt, schnell integriert und am Abend todmüde
sind.“
„Schätzchen, ich kann keine Brücken im Dschungel bauen oder Kanäle durch die Wüste graben. Und du kannst keine Polio-Impfstoffe an Pygmäenkinder verteilen. Wir sind Büromenschen. Die kann man überall
auf der Welt züchten. Aber Lust hätte ich auch.“
„Geht es nicht vielmehr darum, etwas zu tun, was einen tiefen Sinn macht? Dass man irgendwann einmal rückblickend sagen kann: Hier habe ich etwas Wichtiges geleistet,
meinen Beitrag zur Rettung der Menschheit, des Urwalds, der Blauwale oder der Insektenvielfalt am Amazonas?“
„Und das sagt eine, die vor Wespen im Zickzack davonläuft! Aber du hast Recht. Wo bewirbt man sich für so
was?“
„Das finde ich so schön an dir: Du nimmst mich ernst und lässt dich auf jeden Unsinn ein. Manchmal ist man ja mit so einer Idee fertig, sobald man sie einmal durchgespielt hat. Wenn du mich behindern würdest, hätte
ich wahrscheinlich das Gefühl, irgendetwas Abgedrehtes aus purem Trotz tun zu müssen.“
„Warum sollte ich deine lebhafte Phantasie aufhalten? Ich bekomme herrliche Anregungen und Unterhaltung präsentiert, ohne Eintritt
bezahlen zu müssen. Ich könnte keinen ruhigen Abend auf dem Sofa genießen, wenn ich nicht wüsste, das stünde mir für den Rest des Lebens bevor. Hier,“ er reichte Anne seinen Teller, als sie aufstand. „Es
war lecker. Bringst du mir ein Bier aus der Küche mit?“
„Sir, yes, Sir! Auch ein Stück Schokolade für Mr. President?“
„Wenn es keine Umstände macht, James. Wollten Sie immer schon Butler
werden?“
„Sir, es war und ist meine Berufung. In unserer Familie wird man in Livrée geboren.“
„Was ist Livrée?“
„So eine Art Kellnerfrack, glaube ich. Schönes Wort, nicht wahr? Und das Wort hat geweint vor Freude, dass es mal wieder einer benutzt hat. Manche Wörter kommen so selten an die
Luft. Die sitzen in den trüben Kellerräumen eines Lexikons und schimmeln deprimiert vor sich hin. Heute habe ich ein gutes Werk getan: ich habe das Wort Livrée Gassi geführt.“
„Wäre das nicht eine echte
Aufgabe: alte Wörter lüften? Das kannst du nebenbei machen, wir müssten weder umziehen noch Koffer packen.“
Anne kam zurück und reichte Peter die Bierflasche und eine Tafel Schokolade.
„Ich meinte nur
ein Stück Schokolade, aber in deinem Trieb, alle abzufüttern, tischst du immer zu viel auf.“
„Ich möchte nicht, dass du Not leidest bei deiner Mondfahrt, Peterchen. Aber im Ernst: Haben wir eine Lebensaufgabe?
Und wenn ja, haben wir schon damit angefangen?“
„Ich halte es schon für sinnstiftend, wenn man eine glückliche Ehe führt, die Kinder gut aufzieht und sein Geld mit etwas verdient, das keinem schadet. Aber so wie ich dich verstehe, willst du etwas wirklich Großes
tun, nichts Alltägliches.“
Anne beugte sich vor und brach sich ein Stück Schokolade ab. „Allerdings! Irgendetwas, das uns ungeheuer vorwärts bringt. Ich meine nicht nur dich und mich, sondern viele. Es sollte nichts
mit persönlicher Eitelkeit oder Unsterblichkeit zu tun haben. Das würde ich höchstens als unbedeutenden Nebeneffekt akzeptieren. Es ginge mir eher darum, das Werkzeug oder Gefäß dafür zu sein.“
Peter
grinste und zappte durch die Programme. „Klingt nach einer Heiligengeschichte: Als Gott sich Anne auswählte, verließ sie Haus und Hof, ging mit ihrem treuen Gatten Peter in die Berge und entdeckte... tja, das Großartige,
von dem wir heute alle täglich zehren.“
„Mach dich nicht lustig! Ich meine es ernst.“ Anne schob beleidigt die Unterlippe vor.
Peter streckte seine Hand aus, griff nach Annes Hand und drückte einen Kuss
darauf. „Ich nehme alles ernst, was du ernst nimmst, in subjektiver Solidarität.“
„Gut. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass es lustig ist. Irgendwer hat mal gesagt: Worüber man nicht lachen kann, das ist einem auch nicht heilig. Ich glaube, Gott hat nicht nur Sinn für Humor, Gott lacht sogar über
sich selbst.“
„War das nicht das Geheimnis in ‚Der Name der Rose’?“
„Ich weiß nicht mehr so genau, es ist alles überwuchert von Sean Connery in der Mönchskutte. Hast du was dagegen,
wenn du alleine fernsiehst? Ich setze mich ans Notebook und schreibe auf, welche Parameter das Großartige haben sollte, also zu welchen Bedingungen ich mich auf das Abenteuer einlassen würde.“
„Mach ruhig. Hauptsache, du nimmst mich mit.“
„Ohne dich würde ich niemals aufbrechen.“
ZWEI
Anne schrieb: „Meine Bedingungen für das Großartige:
Was ich tue, soll mir und allen Menschen dienen. Insofern muss es gut sein, wobei ‚gut’ noch zu definieren wäre.
Ich brauche einen Namen ohne Bedeutung dafür! Als Zweites nach einem Phantasienamen wie Örft fiele mir sofort Gott ein. Aber sobald es einen Namen hat, bekommt die Sache etwas Ideologisches. Das stört mich. Es soll frei sein.
Es sollte leicht verständlich sein. Ich hasse es, wenn Dinge nur einer Elite zugänglich sind, die lange brauchte, um es zu lernen, sich nur in Fachbegriffen ergeht und es darum ein Geheimnis ist. Trotzdem scheint es bis jetzt ein Geheimnis zu sein, weil ich noch nicht weiß, was es ist.
Darum sollte es auch allen gehören. Jeder müsste Zugang dazu haben. Es muss so selbstverständlich wie Brot oder Luft sein.
Es unterliegt einer Entwicklung, man kann es also ständig verbessern. Es sollte also Linux-Qualitäten haben.
Es müsste mir so viel wert sein, dass ich jedes Opfer dafür bringen würde, ohne dass ich das Gefühl von Verzicht hätte. Einschränkend fällt mir gleich ein, dass ich Peter nicht hergeben will. Das ist ein Opfer, das ich ablehne. Insofern muss es eine Erfahrung sein, die man nicht nur einzeln machen kann, sondern auch zu zweit oder zu vielen.
Man kann sich ihm auf unterschiedliche Weise annähern können. Kein Weg ist der falsche und keiner der einzig richtige.
Liebe ist der Grundkonsens des Denkens, Fühlens und Handelns. Es ist sicher nicht leicht, jeden zu lieben, vor allem, wenn er einem gerade die Parklücke oder den Partner weggenommen hat, oder sich wenig liebenswert äußert oder einfach abstoßend wirkt. Aber der Blick in jedermanns Augen wird bestätigen, dass alle auf der verzweifelten Suche nach Liebe sind. In Allem, was ein Mensch tut, buhlt er letztlich um Beachtung, Anerkennung und Liebe, so sehr er es auch verstecken oder verneinen mag.
Würde man einem Menschen alles geben oder alles nehmen, dies würde immer bleiben. Es ist der Halt des Lebens.
Es ist das Geheimnis des wunschlosen Glücks.
Es wird zu den Dingen gehören, die die Welt retten.
Alles ist davon betroffen. Dieses Großartige, Herrliche, Wunderbare durchzieht das Universum. Es ist so omipräsent wie Atome oder DNA.
Es lässt sich nicht missbrauchen, weil es selbst schlechte Absichten in gute Ergebnisse verwandelt.
Es ist kein Gesetz, sondern Wissen und Überzeugung. Es muss nicht niedergeschrieben oder verabschiedet werden, um wirksam zu sein.
Keiner ist verpflichtet. Jeder ist frei, es anzunehmen oder sein zu lassen.
Es darf niemandem schaden.
Es soll nicht dazu führen, dass die, die daran glauben, sich zur Gruppe der Guten zugehörig fühlen und alle anderen für böse erklären. Mission ist nicht erlaubt, ein überzeugendes Vorbild muss genügen.“
DREI
Anne kam sich vor, als hätte sie ein religiöses Pamphlet geschrieben, die Satzung eines wohltätigen Vereins oder den Grundstock zu einer neuen Weltordnung. Dennoch schien es ihr diffus und längst nicht vollständig. Wen oder was meinte sie: Gott, das Leben, die Liebe, das Grundgesetz, die Regeln des Kosmos, die Zahl 37? Sie fühlte, dass sie sich einer Sache genähert hatte, die ihr viel bedeutete. Warum spülte es sich gerade jetzt an die Oberfläche ihres Bewusstseins? Es konnte durchaus sein, dass Frauen in ihrem Alter diese Phase durchmachten. Manche beantworteten diese Fragen mit Aquarellmalerei in der Toskana, der Sehnsucht nach Enkeln, einer neuen Einbauküche, dem Abdriften ins Esoterische, einem letzten Jobwechsel oder dem Sprung in die Selbständigkeit.
„Es könnten auch die Wechseljahre sein,“ murmelte sie. „Schatz!“ rief sie um die Ecke ins Wohnzimmer. Peter zögerte einen Moment, bevor er seine Aufmerksamkeit vom Fernseher lösen konnte. „Hm?“
„Vielleicht habe ich einfach hormonelle Störungen, und es ist nur der Beginn der Wechseljahre...“
„Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Kerl. Würde dir diese Erklärung helfen?“
„Überhaupt nicht. Es wäre geradezu niederschmetternd, wenn mein Großartiges sich aus dem naturgegebenen Spiel von Molekülen, Enzymen und Rezeptoren herleiten ließe.“ Anne ließ die Schultern sinken.
Sollte es genauso ein Floh in ihrem Kopf sein, wie die Lust auf eine politische Karriere, die Eröffnung eines Suppen-Bistros mit Büchern, der Naturkostladen mit Vollkorn-Muffins? Diese Kurzbrenner hatten sie jeweils ein paar Tage beschäftigt,
bis sie sich als unergiebig, zu aufwendig und risikoreich erwiesen und in den Orkus des Vergessens versanken.
„Ist es nicht egal, was den Anstoß gibt, wenn sich daraus etwas Sinnvolles ergibt?“ rief Peter aus dem Wohnzimmer.
„Ein Mückenstich, ein umgeklappter Regenschirm, ein verpasster Bus können doch fabelhafte Auslöser von weltbewegenden Dingen sein. Vielleicht hatte Einstein nur einen verdorbenen Magen. Am Ende wird es eine nette, menschliche
Anekdote sein, in deinem Vortrag über das Großartige, das du gefunden hast.“
Anne stand auf, ging zu Peter herüber, beugte sich über ihn und küsste ihn auf die Stirn. „Danke, dass du meinen Verrücktheiten
sogar Sinn unterstellst.“
„Stets zu Diensten, Meisterin! Wir haben uns übrigens noch keine Gedanken gemacht, wohin wir nächsten Monat in den Urlaub fahren.“
„Wir haben kein Geld.“
„Einer der schäbigsten Gründe,
zu Hause zu bleiben. Was hältst du von Korsika?“
„Die reden Französisch dort. Ich kann es kaum noch.“
„Ich kann sehr schön ’bonjour’, ’voulez-vous coucher avec moi’ und
’je ne parle pas Français’ sagen. Außerdem sind sprachliche Hindernisse kein Grund, nicht irgendwohin zu fahren.“
„Ich könnte mir einen Ziegenkäse kaufen, der am Ende explodiert, wie in ’Asterix
auf Korsika’.“
„Ich hasse Ziegenkäse. Du müsstest dich entscheiden, mit wem du dort Urlaub machen willst: Ich oder der Käse.“
„Das ist ein sehr schöner Ausgangspunkt. Mach dich mal
schlau. Ich geh ins Bett.“
„Lass das Notebook an. Ich schau mal, was das Internet hergibt zum Thema Käse, Frauen und Sinnsuche auf Korsika.“
Kurzbeschreibung zu „Erleuchtung im Alltag“:
Warum denken wir bloß alle, dass der Weg zu Weisheit und Erleuchtung steinig sein muss? Warum muss alles erkämpft und schwer erarbeitet sein?
Manche sind überzeugt, sie müssten fasten, verzichten und verhärmt aussehen. Die Meisten sind sicher, dass Geld haben und Erleuchtung nicht zusammen passt. Zusammengefasst heißt das Vorurteil: Wenn es nicht schwer ist, weh tut und unerreichbar scheint, dann ist es nichts wert. Wir haben alle ein großes Talent, uns das Leben schwer zu machen und uns zu verurteilen für alles, was wir nicht erreichen.
Hier ist die menschenfreundliche und alltagstaugliche Botschaft dieses Ratgebers: Es ist so leicht, wie du es dir erlaubst.
Jeder von uns hat Erleuchtung, Liebe, Glück, Reichtum, Wohlergehen, Gesundheit und ein langes Leben zutiefst verdient, jeder, ausnahmslos.
Leseprobe:
Inhalt
10 Vorwort
12 Es ist ganz einfach – du musst nichts
13 Es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches
15 Wahrheit ist subjektiv und Wahrnehmung auch
17 Sich in andere versetzen, um sie glücklich zu machen
19 Achte auf deine Worte
21 Achte auf deine Handlungen
22 Achte auf deine Gedanken
24 Wünsch dir was
26 Wir sind nicht unser Körper
28 Es ist genug für alle da
32 Gott ist überall –
keine Religion ist die wahre
34 Ruhe tut gut
36 Erleuchtung braucht keinen bestimmten Ort
37 Erleuchtung braucht keine bestimmte Handlung
39 Angst und Wut ansehen
41 Was ich hasse, ist mein Spiegel
43 Denk regelmäßig
über dich nach
44 Kein nie, immer, nur noch
45 Sei hilfsbereit
48 Bleib da – woanders bist du auch du
50 Erlaube dir, großartig und wunderbar zu sein
52 Träum deinen Traum täglich
54 Wie oben so unten, wie innen so außen
56 Wie fühlt sich Erleuchtung an?
Vorwort
Das hier ist nichts Neues. Man kann diese Gedanken in allen spirituellen Ratgebern von Christentum bis Buddhismus nachlesen. Mal heißen sie ‘Goldene Regel‘, mal ‘Zehn Gebote‘, mal ‘Sutra vom Diamantschneider‘, mal ‘Das Geheimnis‘, mal ‘Bestellungen beim Universum‘ oder der ‘Weg des friedvollen Kriegers‘. Sie sind lang oder kurz, komprimiert oder verschlungen erklärt. Manche ihrer Sprachen verstehen wir, andere nicht. Jeder Kulturkreis hat seine eigenen Zugänge und Bilder. Aber: Sie sind überraschend ähnlich. Sie sind sich erstaunlich einig.
In den letzten Jahren ist in der westlichen Welt der spirituelle Hunger neu erwacht. Jahrzehntelang dachten wir, dass die Wissenschaft uns alle Antworten gibt und damit auch unsere Seele satt macht. Und jetzt sehen wir, wenn wir uns vor dem geistlichen Spiegel betrachten, dass wir „magersüchtig“ geworden sind.
Wir suchen wieder. Wir haben religiösen Hunger. Wir wollen neue Antworten. Wir brauchen ein großes Pflaster für unsere riesige Angst. Wir lechzen nach Mystik und tiefen Geheimnissen. Nicht umsonst sind in unserer Zeit Harry Potter, der Da Vinci Code oder Tintenherz bevorzugte Literatur. Es ist auch erklärlich, warum Bücher wie ‘Gespräche mit Gott‘ oder ‘The secret‘ ganz oben auf den Bestsellerlisten stehen.
Jahrhundertealte Geheimnisse sind inzwischen offenbar geworden. Kein Zerberus versperrt mehr das geheime Tor. Wer sucht, erhält Zugang. So ist auch altes Wissen in verständliche Worte gefasst jetzt für uns verfügbar.
Erleuchtung kann ein missverständlicher Begriff sein, je nachdem, was wir darunter versehen. Erleuchtung ist kein Besitz, es ist ein meist zeitweiser Zustand: gerettet sein, erlöst, erleichtert, verstanden, geborgen, in Sicherheit, wunschlos,
frei, leer, erfüllt … Und dieser Zustand wird durch Training erreicht. Aber vielleicht ein ganz anderes Training als du bisher dachtest.
Dieser kleine Ratgeber ist nichts Besonderes. Er fasst nur zusammen, was für jeden von
uns erreichbar ist. Er ist ein Einstieg, mehr nicht. Das ist das Eine.
Das Andere ist: Wage das Experiment und schau, wohin es dich trägt.
Jeder von uns hat Erleuchtung, Liebe, Glück, Reichtum, Wohlergehen, Gesundheit und ein langes Leben zutiefst verdient, jeder, ausnahmslos. Und jeder und jede kann das alles bekommen.
Mach dich auf den Weg. Jetzt.
Alles Liebe
Regina Bollinger
im November 2007
Es ist ganz einfach – du musst nichts
Warum denken wir bloß alle, dass der Weg zu Weisheit und Erleuchtung steinig sein muss? Warum muss alles erkämpft und schwer erarbeitet sein? Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, sie müssten für höhere Weihen oder
um ein besserer Mensch zu werden Antialkoholiker, Vegetarier oder noch besser, Veganer sein. Manche sind überzeugt, sie müssten fasten, verzichten und verhärmt aussehen. Die Meisten sind sicher, dass Geld haben und Erleuchtung nicht
zusammenpasst. Viele werfen sich vor, gar nicht, nicht richtig oder nicht ausdauernd genug zu meditieren. Zusammengefasst heißt das Vorurteil: Wenn es nicht schwer ist, weh tut und unerreichbar scheint, dann ist es nichts wert. Wir haben
alle ein großes Talent, uns das Leben schwer zu machen und uns für alles zu verurteilen, was wir nicht erreichen.
Diese „Schwergängigkeit“ ist etwas typisch Abendländisches: Besonders die Puritaner und Calvinisten
haben unseren Arbeitsbegriff geprägt. Es ist also ein geistiges „Erbe“ und keine genetische Veranlagung, dass alles hart erarbeitet sein muss. Und darum kannst du dich anders entscheiden. Du darfst es anders fühlen und anders
machen. Der Himmel wird nicht über dir einstürzen.
Dein Weg zu Glück, Reichtum, Zufriedenheit, Erfolg und Erleuchtung ist so, wie du ihn dir vorstellst. Wenn du es schwer haben möchtest, na gut, dann mach es dir schwer.
Aber dein Glück ist nicht weniger wert, wenn es dir entspannt in den Schoß gefallen ist. Leichtigkeit und Fülle, Reichtum und Erfolg, Weisheit dürfen mühelos zu dir kommen. Lass es zu, dass du einfach bekommst und verdienst,
wovon du träumst.
Botschaft: Erlaube es dir, dass es leicht funktioniert.
Es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches
Wir marschieren durch die Welt und verurteilen permanent alles und jeden. Der ist ein Idiot, weil er das und das sagt oder tut. Jener ist ein Schwein. Die da oben oder die da unten wissen gar nicht, wie unrecht sie haben.
Wir benehmen uns alle
furchtbar oberlehrerhaft und weisen mit erhobenem Zeigefinger jeden, der uns auf die Nerven geht, auf seine vermeintlichen Verfehlungen hin. Wir können uns ereifern, rasend vor Wut werden, wir möchten die Idioten schütteln und zur
Räson bringen.
Woher nehmen wir eigentlich die Überzeugung, im Recht zu sein?
In unserem Leben hat sich die Einstellung, was richtig und was falsch ist, öfters geändert. Oder glaubst du noch an die gleichen Dinge
wie in der Kindheit? Wir haben politische Ansichten gewechselt. Was wir als Jugendliche für erstrebenswert hielten, ringt uns als Erwachsene ein nachsichtiges Lächeln ab. Es gab eine Zeit, da wurden Hexenverbrennungen für richtig
gehalten, und es gab eine Zeit, da fand man sie falsch (natürlich sind wir Heutigen uns einig, dass es grausam, schrecklich, unmenschlich war, aber damals meinten Menschen, es sei richtig. Es geht hier um extreme Beispiele für richtig
und falsch).
Mag sein, dass du einen Kollegen für ein ausgemachtes Arschloch hältst, aber es gibt jemanden, der ihn – sogar in der gleichen Situation – wunderbar findet.
Es ist alles nur eine Frage der Perspektive.
Rechthaben funktioniert nur, wenn sich zwei oder mehr Leute vorher darauf geeinigt haben, was das im Einzelnen bedeutet. So funktionieren auch Gesetze: Wir (oder unsere von uns gewählten Vertreter) haben sich darüber geeinigt, was wir
derzeit für richtig und falsch halten. Es ist nichts Endgültiges, es ist nur eine zeitweise Einigung. In 200 Jahren wird es andere Gesetze geben.
Die Buddhisten sagen, die Dinge seien an sich weder gut noch böse, sie seien
‘leer‘ oder neutral – ein Messer ist eigentlich nichts Schlechtes, es ist ein Messer, mehr nicht. Aber ein Mensch erlebt es durch seine Interpretation, seine Wahrnehmung als gut, wenn es das Brot schneidet, oder schlecht, wenn
er damit angegriffen wird.
Nur weil du keinen Fisch magst, müssen nicht alle anderen aufhören Fisch zu essen. Nur weil du gern um sieben Uhr zu arbeiten anfängst, müssen nicht alle anderen auch um sieben antanzen.
Wir haben nicht das Recht, uns über andere zu ereifern und sie zu verurteilen. Wenn du die Meinungen anderer Leute nicht ertragen kannst, dann gehe ihnen nicht damit auf die Nerven. Du darfst gern sagen, was du denkst, aber zwinge keinem
deine Meinung auf. Dein Urteil ist nur eins im Konzert von vielen. Auch das Gegenteil davon kann irgendwann, in einer anderen Situation, unter veränderten Umständen, einmal für richtig gehalten werden.
Alles, was dir begegnet,
ist von sich aus zunächst neutral. Darum kommt alles, was dich daran freut oder ärgert, aus dir heraus und nicht von der Sache oder Person. Wie etwas ist, das liegt an deiner Projektion. Du bist der Projektor, aber du regst dich über
die (von dir selbst) projizierten Bilder dir gegenüber (also sozusagen auf der Leinwand, beim Gegenüber) auf oder freust dich über sie, als hättest du vergessen, dass du sie erzeugt hast.
Sei also nachsichtig mit dem Urteil anderer, gerate nicht über sie in Wut, lass jeden tun, was er derzeit für richtig hält. Denn es ist nicht der andere, der dich ärgert, sondern dein Bild über ihn in deinem Kopf.
Nutze jede Erfahrung, die du machst, jedes Gefühl, das du erlebst, als Lernprogramm, das dich bereichern kann.
Wenn das, was du für richtig und falsch hältst, in deinem Leben funktioniert, ohne andere zu beeinträchtigen,
dann ist schon viel gewonnen.
Botschaft: Urteile nicht, zwinge nicht – wähle nur für dich.